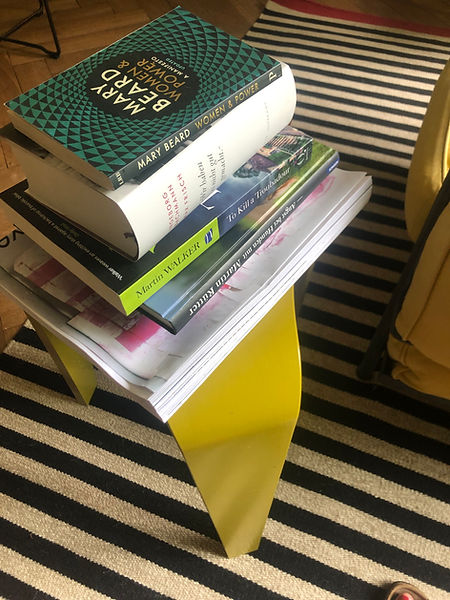


Lektürejournal 2026
Ian McEwen: Was wir wissen können. Zürich 2025.
McEwan legt mit Was wir wissen können ein Meisterwerk zeitgenössischen Erzählens vor. Stoff, Sprache, Roman-Architektur sind schlicht hinreißend. Allerdings, wie Besprechungen des Werks in einschlägigen Talkshows verdeutlichen, ist meine Beurteilung keineswegs unbestritten. Einer der zahlreichen Gründe für die deutlich kontroverse Rezeption des Romans mag in der Tatsache liegen, dass das Auge der Erzählerinstanzen in ganz ungewöhnlicher Art und Weise auf eine heute noch lebende Generation fällt, die in den 50-er, 60-er und 70-er Jahren des 20. Jahrhunderts in europäisch bildungsnahem Milieu erwachsen geworden sowie akademisch ausgebildet ist und sich in stupender Weise in diesem Roman erkannt und in gewisser Hinsicht vorgeführt sieht. Meisterhaft eben.
Doch zunächst ein Schritt zurück: Gegenwartskontext der erzählten Welt ist im ersten Teil des Romans das frühe 22. Jahrhundert in einem geografisch und klimatisch, politisch, kulturell und technologisch sehr veränderten Europa. Die Erzählerfigur, ein Literaturwissenschaftler und Lyrik-Spezialist für den Zeitraum zwischen 1990 und 2030, ist besessen von der Suche nach einem verschollenen Sonettenkranz. Von diesem traditionellen und vermeintlich unerreichten Meisterwerk der lyrischen Darstellungskunst ist durch Zeugnisse belegt, dass es existierte, an einem datierbaren Tag rezitiert, aber nie veröffentlicht wurde. In aufwändigen Recherchen rekonstruiert der Erzähler deshalb das Leben und die Lebensumstände des längst verstorbenen Autors dieses Kunstwerks, die einmalige Rezeption des Kranzes sowie seine erstaunliche Wirkungsgeschichte in der Hoffnung, das Gedicht über irgendeinen Hinweis in den zugänglichen Quellen dereinst zu Gesicht zu bekommen.
Die Gegenwart der erzählten Welt im zweiten Teil des Romans ist das frühe 21. Jahrhundert. Als Schauplatz fungiert jenes Westeuropa, wie es Leserinnen und Leser im Erscheinungsjahr des Romans kennen. Erzählt wird dieser zweite Roman-Teil von der Frau des Sonettenkranz-Dichters. In ihrer autobiografischen Lebensdarstellung gibt sie preis, wo der Sonettenkranz abgeblieben ist.
Die Imagination eines Rückblicks auf die heutigen Verhältnisse im ersten Roman-Teil sowie die Imagination einer ergänzenden und durchaus auch korrigierenden Innensicht genau dieser Verhältnisse im zweiten Roman-Teil eröffnen McEwan ein Feld an brisanten Möglichkeiten, die nur er, der Romancier, hat. Er kann im Roman Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges (!) nicht nur beschreibend darstellen, reflektieren und allenfalls kritisieren, er ist in der Lage, es narrativ zu konkretisieren.
Wie McEwan den Erzählduktus in den Roman-Teilen variiert; wie er das Konzept des künstlerischen und/oder gelehrten Genies als altbacken brandmarkt und in der Figur des Sonettenkranz-Dichters verkörpert; wie er den wissenschaftlichen Eskapismus hinterfragt; wie er den Prozess der Reproduktion des Historischen über das Quellenstudium einer exorbitanten Menge an digitaler Information ins Auge fasst; wie er eine europäische Zukunft imaginiert, ohne in einen aufdringlichen Science-Fiction-Modus zu verfallen; wie er schließlich eine quasi feministische Pointe platziert – in all dem zeigt sich die Virtuosität des Autors. Form und Inhalt sind gleichermaßen bedeutungstragend und bedeutsam.
Ein Thesenroman also, wie von Kritikern gesagt wurde? Oh nein. Der Meister des akademischen Milieus erschafft keine eindimensionalen Figuren bzw. Träger einer gesellschaftspolitischen Position. Seine fiktiven Gestalten benehmen sich in der erzählten Welt des 21. wie des 22. Jahrhunderts ziemlich menschlich, ziemlich verrückt, »schaffen es immer mit Ach und Krach« (277) und taugen weder als Modelle noch als Antiheldinnen und -helden. Sie wundern sich gelegentlich – es wundern sich genauso die Leserinnen und Leser des Romans –, wie sich das Leben zwischen Buchdeckeln anfühlen kann, als sei es das reale. »In der Bodleian [Bibliothek in Oxford] frage ich mich manchmal, ob ich nicht an einer milden Form von Demenz leide. Blicke ich von meinen Papieren auf […] in den Raum mit den stummen Wissenschaftlern, kann ich mir einreden, dass ich träume, dass meine wache Realität innerhalb dieser Seiten stattfindet. […] Ich bin dort« (48), sagt der in die Vergangenheit verliebte Literaturwissenschaftler und gleichzeitig: »Unsere entschiedene Loyalität muss stets der so lauten wie erbarmungslosen Gegenwart gehören.« (275)
*******Für Literaturbegeisterte, die um die Mitte des 20. Jahrhunderts geboren sind.
Lektürejournal 2025
Ben Markovits: The Rest of Our Lives. London 2025.
»What do you want to do now? […] The kids are all grown up.« (239) Um diese einfache Frage dreht sich Markovits‘ kleiner feiner Roman. Was, wenn der Familienverbund sich auflöst, weil die Kinder ausziehen und ihr eigenes Leben leben – und das Elternpaar ‚verwaist‘? Die Erzähler- und Hauptfigur weiß es nicht. Sie hat keine Ahnung, außer: Nach dem Verabschieden von der Tochter in deren Universität fährt sie nicht heim. Im Vakuum zwischen der Familien-Ära und einer irgendwie gearteten Nach-Epoche (The Rest of Our Lives) muss der Vater zweier erwachsener Kinder und der Ehemann einer extrem schönen Frau auf den unendlichen Straßen der USA allein sein.
Wie bereits jetzt klar geworden sein sollte, liegt die Qualität von Markovits‘ Roman keineswegs im Neuerfinden von erzählender Literatur. Eher im Gegenteil. Der Autor betont Altbekanntes so stark, dass es geradezu schmerzt. Da ist die wieder und wieder thematisierte Problematik der Paarbeziehung im Familienzusammenhang, dann die traditionelle Road-Movie-Architektur. Auch der Auslöser und das Ende der Narration sind gewissermaßen unoriginell. Umso hinreißender rockt der Erzähler das Dazwischen. Markovits zeichnet eine männliche Figur mittleren Alters, die den Lesenden den Kopf verdreht und sie schlagartig wissen lässt, warum sie sich immer wieder in Männer verlieben können. Ist es der bekannte Charme des Antihelden, dem sie verfallen? Wie dem auch sei: Markovits lässt den flüchtigen Ehemann seine Frau in der Erinnerung zitieren, wie sie an einer Party im Freundeskreis beklagt »It’s just that trying to get him to talk about anything when we’re alone is like getting blood from a stone« (44). Eben dieser Ehemann erweist sich in der Erzählerrolle als unverkrampft warmherziges, mitteilsames, selbstkritisches, loyales, reifes, humorvolles, intelligentes, reflektierendes Individuum. Der Stein lebt. Er spricht. Wenn er sein vergangenes Leben erinnert, wenn er die amerikanische Gegenwartswelt seiner Bekannten in Details beschreibt, wenn er schweigt, fährt und denkt, ist nichts, aber auch gar nichts blutleer.
******Für Menschen jeden Alters, die schon an den »Rest« ihres Lebens denken
Ayelet Gundar-Goshen: Ungebetene Gäste. Zürich - Berlin 2025.
Gundar-Goshen ist eine Romancière von Gnaden. Sie legt mit Ungebetene Gäste ihr temporeichstes und nicht ihr bestes Buch vor. Warum es trotz der thematischen Überlastung und einem gewissen Mangel an Konzentration unbedingt lesenswert ist, hat mit der expressiven Schärfe der Autorin und ihren hoch bedeutsamen Fragestellungen zu tun. Ihre Literatur lässt wahrnehmen, mehr noch: quasi miterleben, was mit Menschen passiert, die der Willkür von Gewalt in den verschiedensten Formen über längere Zeit hinweg ungeschützt ausgesetzt sind; wie verheerend sich eine Aufmerksamkeit der latenten Bedrohung in alltäglichen Szenerien breitmacht und die zwischenmenschliche Kommunikation korrumpiert. Es wird durchsichtig, dass und wie Kinder in der Atmosphäre der kollektiven Ängste sozialisiert werden und diese sozusagen notgedrungen erben.
Die Schauplätze der Verstörung durch Angst vor Gewalt sind in diesem Roman Israel sowie im zweiten Roman-Teil eine Expat-Community in Nigeria. Wie auch in anderen ihrer Romane greift Gundar-Goschen narrativ weit über die Grenzen des Nahostkonflikts hinaus. Gewaltverschonte Fluchtorte gibt es auf dem Planeten Erde ja nicht, obwohl schon nur das hohe Gut des Gewaltmonopols an einigen Flecken deutlicher zum Tragen kommt als an anderen.
Nur gute Literatur kann ahnen lassen, wie spezifisch eine fremde Angstkultur im Alltag wirkt. Denn Literatur ist radikal konkret. Auge und Ohr der Fiktion sind so unverschämt wie unbarmherzig. Gundar-Goshen lässt die Lesenden ins Wohn- und Schlafzimmer einer jungen, gebildeten Mittelstandsfamilie eintreten, nimmt die Leserinnen und Leser mit ins multikulturelle Stadtquartier sowie in einen arabischen Vorort, lässt sie Platz nehmen auf den Kissen einer Großfamilie und entführt schließlich in ein Expat-Viertel an der Küste von Nigeria. In atemloser Tuchfühlung erzählt sie vom Versuch einer jungen Familie, gut zu leben, besser zu leben, sicher zu leben.
Im Anschauen des Fremden im Roman biegt sich der Blick unweigerlich aufs Eigene zurück. Welche individuellen und kollektiven Ängste torpedieren Verbindendes in Westeuropa? Wo, wann und wie manifestieren sie sich? Und, ganz wichtig: Wie kann die Dankbarkeit der weitgehend Verschonten – weil zufällig in einem eher befriedeten Land Geborenen – individuell und politisch produktiv werden?
*****Beneidenswert, wer Gundar-Goshens Romane noch nicht gelesen und die Autorin in Interviews noch nicht gesehen und gehört hat
Patrick Holzapfel: Hermelin auf Bänken. Berlin 2024.
Schauplatz des hinreißend zarten Romans ist Wien. Holzapfels Protagonist lässt sich nach dem Tod seiner Mutter nicht gehen, nein, er sitzt auf den im Roman exakt lokalisierten Bänken der europäischen Prunk-Metropole. Diese Handlung nennt er »Bankieren«: Sitzen, Schauen, Wahrnehmen, Reflektieren und Erinnern, in seinem Fall überdies Notieren. Stundenlang, tage- und nächtelang. Warum das? Wozu? »Niemand soll sich erklären müssen, warum er gern auf Bänken sitzt« (32), antwortet der Student auf die Frage, die er sich durchaus auch selber stellt, und fügt an, »aber teilen« (ebd.) möchte man das Gefühl des Bankierens allemal. Und das am liebsten mit den professionellen Wohnsitzlosen, denjenigen, die in Wien Sandler genannt werden, und am allerliebsten mit dem Sandler im Hermelinmantel. Denn er, der Adelige vom Karlsplatz und einstige Regent der Obdachlosen, der seit der brutalen Säuberung des Karlsplatzes einzig und allein in seinem weißen Hermelinumhang wohnhaft ist, könnte womöglich die Lebensqualität des Bankierens mitfühlen.
Auch die Lesenden von Holzapfels romanesker Kleinform können genau das spätestens am Ende der bankierenden Suche nach dem Hermelinkönig. Dann nämlich, wenn sich mit dem Geräusch des Reißverschlusses am Leichensack des Sandlers die Trauer des Sohnes um seine Mutter transformiert.
In Hermelin auf Bänken fällt ein junger menschenfreundlicher Blick auf des Lebens unfreundliche Seiten – auf Krankheit, gesellschaftliche Ausgrenzung, Armut, den Tod, auf unumgängliche Ernüchterungen und Verluste –, und es entsteht ein literarisches Kammerspiel, das aufrichtet, ohne zu beschwichtigen.
******Pflichtlektüre vor jeder Wienreise
Joy Williams: Stories. München 2023.
[Erstveröffentlichungen der aus dem Englischen übersetzten Texte: New York, 1972 bis 2014]
Joy Williams (*1944) hat in den Stories einen Erzähler mit dem tiefenschärfsten Blick für das Alltagsgrauen des postmodernen westlichen Menschentiers entwickelt. Dieser Blick fördert ans Licht, was in menschlichen Verhältnissen vorgeht, wann immer der Firnis der Zivilisation Risse bekommt oder aber als die humane Errungenschaft verheerende Wirkung entfaltet. Das Thema ist nicht neu, die energische Distanziertheit der Bearbeitung aber schon. Williams nähert sich der Problematik nicht im autofiktionalen Rausch. Vielmehr widmet sie sich der Vielfalt der menschlichen Verrückt- und Verlorenheiten in der immer wieder gnadenlos unfassbaren Welt.
Die Stories aus den vergangenen fünf Jahrzehnten bieten (amerikanisch) Umwerfendes:
Skurrile Szenerien, blitzgescheite Figurencharakterisierungen und -konstellationen und darüber hinaus viel Boshaftes und Zartes. Beispiele gefällig? Ein altes Ehepaar tritt seinen Nachlass und Lebensinhalt, die milchtrinkende Riesenschlange Lu-Lu, an die nächste Generation ab, die sich aber leider außerstande sieht, das Erbe auch nur ins eigene Auto zu bekommen. »Wie lockt man so etwas herbei […], etwas, das alles verändern kann, mein Leben?« (124) Dann: Die Figur des Predigers Jones mit seiner kolossalen Liebe, die »soweit er es beurteilen kann, nie jemandem genützt [hat]« – sie »ist viel zu offensichtlich und weckt Gleichgültigkeit«. (7) Weiter: Der alte Ehemann, der seine Frau schon als Baby kannte und zu ihrem Kinderwunsch meint: »Du warst mal ein kleines Baby. […] Ist das nicht genug?« (110) Schließlich: Mays Sohn sitzt in der Todeszelle. »Die letzten Dinge, die May ihrem Sohn gebracht hatte, waren ein dunkler Anzug und ein weißes Hemd. […] Sie hatte das Hemd gekauft und zu Hause mehrmals gewaschen, damit es weich wurde, und war dahingefahren, an diesen Ort. […] Sie hatte so einem idiotischen Schicklichkeitsgefühl nachgegeben, und jetzt packte sie Entsetzen – das Entsetzen, das jenseits der Furcht vor dem Tod lag.« (211f.)
Belangvolle Literatur zeichnet sich u.a. dadurch aus, dass Form auch Inhalt ist. Darum ein Wort zur Sprache und zur Textarchitektur der Stories. Williams‘ Sprachverwendung gleicht über weite Textpassagen hinweg einem parataktischen, temporeichen Hämmern. Der rhythmische Sog nach vorn ist nicht ausschließlich der englischen Originalsprache und auch nicht allein der Erzählgattung Shortstory geschuldet. Die Autorin demonstriert sprachlich, wie sie weder ein Starren in den Abgrund noch das Zelebrieren des Schreckens duldet. Vielmehr scheint sie für das Wahrnehmen und Aussprechen dessen, was ist, einzustehen – und für das Weitergehen. Sieht sie sich womöglich in der Tradition von William Butler Yeats (1865-1939), dessen viel zitierter Imperativ lautet: »Cast a cold eye/ On life, on death./ Horseman, pass by!«? Ich bin mir nicht sicher. Fest steht nur, dass ihr Blick vollkommen wach, aber nicht vollkommen kalt ist.
Für Wachheit als implizite Aufforderung an die Rezipierenden spricht neben dem Erzähltempo auch die Textarchitektur. Der zielstrebige Anfang der Geschichten aktiviert, da kaum expositorische Information vergeben wird. Die Lesenden sind genötigt, sofort Hypothesen zu bilden und diese laufend zu revidieren (Lu-Lu könnte die Tochter des alten Ehepaars sein? Vielleicht eine Enkelin? Eine Freundin?). Auch im inhaltlich kontrastreichen Hauptteil der Stories ist Neuorientierung wieder und wieder angesagt, bis die Texte ohne jede Verzögerung mit einer meist frappierenden Schluss-Sequenz abreißen.
Ich will mehr von Williams lesen. Einen ihrer Romane unbedingt, denn die Lektüre der Stories ist beklemmend, berührend – und sie weitet. Das ist Literatur! Das ist Qualität!
*******Für Lesende, die (nicht-hermetische) Literatur mögen, der sie nur ganz bedingt beikommen
Patrick Bringley: All the Beauty in the World. A Museum Guard’s Adventures in Life, Loss and Art. London 2024.
Selten küre ich bereits vor Jahresende mein Buch des Jahres, noch seltener bereits im Frühling. Bei Bringleys Titel besteht allerdings kein Zweifel – er ist mein Buch des Jahres 2025. Ich habe langsam gelesen wie nie sonst, untypisch auch nur wenige Seiten in einem Zug. Zwischen den zwei Buchdeckeln fand ich Raum zum Atmen wie in den ersten Büchern meiner Kindheit. Ein doppeltes Staunen auch, ein doppeltes Entzücken darüber, wovon die Rede ist und wie die Rede ist in dieser Betrachtung des Lebens, der Welt und der Kunst.
Zunächst also: Was wird thematisiert? Die Erfahrung eines jungen Mannes, den großen Bruder zu verlieren; wohin Trauer ihn führt, wie er an diesem Ort lebt und ihn nach zehn Jahren wieder verlässt; der Arbeitsalltag eines Assistenten im Besucher- und Aufsichtsdienst eines bedeutenden internationalen Kunstmuseums, seine Tages- und Wochenrhythmen; das Spektrum an geregelten und informellen Interaktionen der im Museum Tätigen sowie Anstellungsbedingungen, Arbeitspläne, Rollenhierarchien, Sicherheitskonzepte; die Räumlichkeiten des Museumsbaus, auch die für Außenstehende unzugänglichen; der Blick auf die Menschen, die das Museum besuchen, und auf alle, die im Museum arbeiten; eine Typologie der Kunstbetrachtenden. Und natürlich: Große und kleine Kunstbestände des Metropolitan Museums of Art (Met) in New York.
Wie finden all diese Themen in ihre sprachliche Vergegenwärtigung? Bringley erweist sich als Meister einer Sprachverwendung, die reflektierende Innenschau und präzise Weltwahrnehmung, Detailversessenheit und Sinn für Übergreifendes in ein nie dagewesenes Gleichgewicht bringt. Die Intensität seiner nach innen und außen gerichteten Wahrnehmung prägt einen Duktus, der auf die Verbindung des Selbst mit der Welt abzielt, der Gegenwart und Geschichte, Trivialität und Exzellenz, Kunst und Alltag in einer Zusammenschau verstanden wissen möchte. So geht es denn beispielsweise in seinen Kunstbetrachtungen nicht um kunsthistorische Gelehrsamkeit – obgleich diese durchaus eines seiner geistigen Arbeitsinstrumente ist –, sondern um Zugang zu den connecting patterns in der künstlerischen Darstellung von menschlichem Leben bzw. humaner Erfahrung im Laufe der Jahrhunderte und in den verschiedensten kulturellen Kontexten. Der Sinn einer Sammlung von Kunstschätzen dieser Erde erschöpft sich denn in Bringleys Darstellung eines Museums-Kosmos nicht etwa darin, etwas über Kunst zu lernen. Betrachtende sollen vielmehr von ihr lernen, Kraft schöpfen in der Schönheit und Wahrhaftigkeit der im Werk aufgehobenen humanen, künstlerisch reflektierten Arbeit.
Diese Funktion von Kunst ist nach Bringley in ihrer Wirkung auch außerhalb der Kunst-Sphäre (und damit auch jenseits der Buchdeckel des gerade besprochenen Ausnahme-Titels) sehr konkret. »Find out what you love in the Met, what you learn from, and what you can use as fuel, and venture back in the world carrying something with you, something that doesn’t fit quite easily in your mind, that weighs on you as you go forward and changes you a little bit.« (178)
********Für alle, die Kunst nicht nur, aber auch, als Treibstoff für das Leben ihres Lebens erfahren
Timothy Snyder: Über Tyrannei. Zwanzig Lektionen für den Widerstand. München 2023 (9. Auflage).
Snyders Perspektive auf Fragen zum Projekt Demokratie ist weit mehr als interessant oder erhellend – sie ist im aktuellen historischen Moment orientierend. Der amerikanische Historiker, ein Spezialist für osteuropäische Demokratien, hat für seine Arbeit nicht nur europäische Sprachen gelernt, sondern lange Zeit in verschiedenen, insbesondere östlichen Demokratien Europas gelebt. Er legte 2017 in New York ein Manifest vor, das zivilgesellschaftliche Handlungsmöglichkeiten zum Schutz des Experiments Demokratie aufzeigt.
Die Demokratien der Welt waren und sind fragile politische Gebilde und stets von Tyrannei bedroht. Das heißt konkreter, gegen das Übel der »Machtübernahme durch eine Einzelperson oder eine Gruppe oder daran, dass die Regierenden das Gesetz zum eigenen Vorteil um[gehen]« (10) ist die Demokratie nie gefeit. Die Geschichte lehrt jedoch, wie sich Widerstand gegen die stets neuen Formen der Tyrannei in Zeiten der akuten wie latenten Bedrohung artikuliert. Und solche Lehren fasst Snyder in seinem Manifest für die Demokratie zusammen.
Gerade mal zwanzig Handlungsanweisungen bringt der Historiker auf den Punkt. Er formuliert Imperative, erläutert sie in einer Kurzfassung und führt sowohl begründend als auch illustrierend Ereignisse, Fakten, Zahlen aus der Geschichte der Demokratie des 20. Jahrhunderts in Europa an. Überdies zeigt er mit Handlungen und Äußerungen von Persönlichkeiten aus verschiedensten gesellschaftlichen und beruflichen Bereichen auf, was Widerstand gegen den rechten und linken Autoritarismus bedeutet und wie er wirkt.
Snyder ist kein Utopist. Seine Analysen und Stellungnahmen entlasten nicht als tröstende oder besänftigende, sondern als wahrhaftige. Sie wecken auf und eröffnen (Handlungs)Perspektiven. Denn, wie der Historiker auf Youtube meint, »Demokratie, wo sie denn tatsächlich existiert, ist kein Ding irgendwo in der Welt draußen, sie existiert in uns selbst als Wille und Wunsch, Regeln zu setzen. […] Demokratie ist etwas, das wir tun, also eher ein Verb als ein Nomen, auch wenn das natürlich grammatikalisch völlig falsch ist« (Timothy Snyder, Is Democracy Doomed? Abgerufen am 27.02.25, übersetzt von rsb). Was ist also zu tun?
1 Leiste keinen vorauseilenden Gehorsam / 2 Verteidige Institutionen / 3 Hüte dich vor dem Einparteienstaat / 4 Übernimm Verantwortung für das Antlitz der Welt / 5 Denk an deine Berufsehre / 6 Nimm dich in Acht vor Paramilitärs / 7 Sei bedächtig, wenn du eine Waffe tragen darfst / 8 Setze ein Zeichen / 9 Sei freundlich zu unserer Sprache / 10 Glaube an die Wahrheit / 11 Frage nach und überprüfe / 12 Nimm Blickkontakt auf und unterhalte dich mit anderen / 13 Praktiziere physische Politik / 14 Führe ein Privatleben / 15 Engagiere dich für einen guten Zweck / 16 Lerne von Gleichgesinnten in anderen Ländern / 17 Achte auf gefährliche Wörter / 18 Bleib ruhig, wenn das Undenkbare eintritt / 19 Sei patriotisch / 20 Sei so mutig wie möglich
********Für Menschen, die, gegen jede grammatikalische Vernunft, Demokratie als Verb verstehen
Behzad Karim Khani: Als wir Schwäne waren. Berlin 2024.
Migrantinnen und Migranten sind, wenn sie in Europa ankommen, nicht gerettet.
Das wissen Menschen mit offenen Augen natürlich oder ahnen es auch bloß, stellen jedoch nach der Lektüre des Romans von Khani erschüttert fest, wie papieren dieses Wissen war, wie einfach es sich im Alltag ausblenden ließ. Sie merken, wie es der Literatur, dieser Literatur, gelingt, das Wissen zu transformieren, es in die Körper der Lesenden zu transportieren und es dort zum Faktor werden zu lassen, der verändert.
Worum geht es? Khanis Erzähler stellt sich, wie er explizit im Roman erklärt, neben seine Eltern und neben das Kind, das er mit zehn war, als seine Familie nach der Flucht aus dem Iran in den 90-er Jahren des 20. Jahrhunderts im Ruhrgebiet landete. Er stellt sich neben die Erinnerungen, neben die Demütigungen, die Wut, den Zorn, die Ängste, die Feigheit, die Ohnmacht dieser Menschen, neben ihre Überlebensstrategien auch, ihre Genugtuung und Befriedigung, ihren Stolz, ihr Niveau, ihre Ideen von einem Weitermachen. Er stellt sich neben ihre Entwicklungsschritte in einer Siedlung am Rande von Bochum, »Hier, wo von nichts nichts kommt. Man auf einem Bein nicht stehen kann. Wo man nicht aus Zucker ist. Keine Müdigkeit vorschützt, Nägel mit Köpfen macht und sich nicht zwei Mal bitten lässt. Wo man schließlich nicht blöd ist. Wo sicher sicher ist und Geiz geil. Wo ‚Du bist Gast hier!‘ eine Drohung ist. Wo ja jeder kommen kann« (173), wo man die Hunde vor den Menschen grüßt, wo es neben der stinkenden die schlimmere geruchlose Armut gibt und todbringende Gewalt. Wo den Eltern klar wird, dass es für den Sohn nichts gibt, »wofür es sich zu brennen lohnt« (168).
Wie Khani aus der Perspektive der Verbundenheit mit seinen Haupt- und einigen Nebenfiguren auf die Dinge schaut und sie zur Darstellung bringt, ist ganz außerordentlich, ein kaum zu überbietender sprachlicher Kraftakt. Neben den Figuren stehen heißt in seinem Fall auch, ohne Wenn und Aber zu ihnen stehen. Jedes Wort, jeder Satz scheint sich der erlebten und erlittenen Realität dieser Menschen würdig erweisen zu müssen hinsichtlich Wahrhaftigkeit, Intensität und Tonfall.
Ich habe den Begriff Hochliteratur lange nicht gebraucht. Zu traditionell war er wohl, zu sehr auf die Bildungselite mit ihrer kanonischen Auswahl in der Literaturgeschichte bezogen. Und plötzlich taucht er in mir im Zusammenhang mit diesem jungen Autor auf, der ein nie gehörtes und nie gelesenes Deutsch schreibt, um zu sagen, was er zu sagen hat. Das ist seit jeher exakt die Schreibarbeit, die Kunst hervorbringt – und seit jeher äußerst selten. Künstlerinnen und Künstlern ging es in der Literaturgeschichte, wenn sie denn tatsächlich Kunstschaffende und nicht einfach Kalligrafinnen oder Kalligrafen ihres Fachs waren, nie darum, eine neue Art und Weise der künstlerischen Artikulation schlicht um der Neuheit willen zu finden. Immer waren es neue Befindlichkeiten, Erfahrungen und Lebenssituationen, die nach neuen Darstellungsarten verlangten. Bezahd Karim Khani hat sich eine deutsche Sprache für das Erzählen von einer aktuellen Realität in Zentraleuropa erarbeitet, die weder bemüht noch hermetisch oder gekünstelt wirkt. Vielmehr überrascht sie. Überwältigt. Sie springt in Richtungen, die man dem Deutsch bislang nicht zugetraut hätte. Khanis Literatur ist in diesem Sinn Hochliteratur – und der Autor selbst ein großartiger Künstler.
*******Für Lesende, die immer wieder «Meter machen» wollen.
PS: Der Ich-Erzähler sagt auf Seite 170:
»Ich muss auf die Beine kommen, denke ich. Meter machen. Erst dann kann ich Fragen nach Zukunft und Leidenschaft stellen. Ich brenne für gar nichts. Ich brenne nur weg.«
Raoul Schrott: Die Kunst an nichts zu glauben. München 2015.
Zum Jahresanfang präsentiere ich ein unkommentiertes Zitat aus einer mittelalterlichen Schrift, übersetzt von Raoul Schrott:
« die eigentliche kunst ist unsicher zu bleiben – fähig zwei einander widersprechende ideen gleichzeitig im kopf zu halten: das wissen um die vergeblichkeit jeder anstrengung und den glauben an die notwendigkeit des aufbegehrens » (VIII.2, S. 124)
Lektürejournal 2024
Ulrike Draesner: zu lieben. München 2024.
Zum Jahresabschluss mein Jahres-Roman. Draesner ist mir bekannt als Lyrikerin, die auf dem Feld der Poesie erstaunliche Stoffe stemmt (siehe Gedichtjournal 2024 unter dieser URL). Jetzt das. Ein Roman über die Adoption eines dreijährigen Mädchens aus Sri Lanka. Das Erzähler-Ich, die auf der Gegenwartsebene des Romans zur Mutter der Tochter gewordene Figur, rekonstruiert erinnernd, was es heißt zu lieben. Wenn ich das Thema des Romans so krass und ohne weitere Differenzierungen auf den Punkt bringe, kann das Buch nur Kitsch sein oder aber erschütternd gut. Es ist letzteres. Leserinnen und Leser werden ganz einfach von Deutschland aus mitgenommen auf den Weg zu einem Kind, das seit seiner Geburt in Colombo in einem Kinderheim lebt. Dass das Erzählte die Lesenden gleichzeitig mit der entscheidenden Frage konfrontiert, was es ganz außerhalb der vorliegenden Adoptionsgeschichte heißt zu lieben, verdankt sich der literarischen Kapazität dieser Autorin. Sie konstituiert ein aufgeklärtes, gebildetes, in Selbstreflexion geübtes Erzähler-Ich, das dokumentiert, was mit ihm im Adoptionsprozess geschieht. Was es im Wissen um die Würde und Freiheit des kindlichen Gegenübers, das sie lieben möchte, tut. Die Antwort auf die im Roman zentral gestellte Frage nach der Liebe ist also sehr konkret und darum wohl eine der besten, die Lesenden zukommen kann: Schaut euch diese Frau in diesem Roman an, schaut euch an, was sie im Zusammenhang mit dem Wunschkind vorkehrt, investiert, wartet, verzichtet, feiert, jubelt, ersehnt, zweifelt, genießt, bereut, korrigiert, stolpert und stürzt, überlegt, lernt, verliert und gewinnt. All das bedeutet in ihrem Fall zu lieben.
******* Liebe zieht nackter aus als Sex und zählt wie das Leben selbst
Han Kang: Die Vegetarierin. Berlin 2024.
Die Originalausgabe dieses Romans der Nobelpreisträgerin für Literatur 2024, Han Kang, ist bereits 2007 in Seoul erschienen.
In drei Teilen entfaltet Han das Porträt zweier verschwisterter bzw. verschwägerter Ehepaare. Gnadenlos zieht sie in einem Kammerspiel den Schleier des Anstands und der Funktionalität der Paare weg, um unartikulierte Bedürfnisse, Motive, Phantasien und Traumata der vier im Zentrum stehenden Figuren zu enthüllen oder besser: erzählend zu umkreisen. Die Geheimnisse der Figuren bleiben trotz narrativer Innensicht bestehen, und das selbst auf dem Gelände der Psychiatrie mit ihren Etikettierungen.
(Fast) ausschließlich über Beschreibungen der drei anderen Zentralfiguren lernen die Lesenden die titelgebende Protagonistin kennen. In jedem der drei (darum nicht vier!) Romanteile erschließt sich denn genau eine Perspektive auf ›Die Vegetarierin‹, die sich mit ihrer Krankheit zum Tode bzw. zur erlösenden Gattungstransformation – sie setzt alles daran, das Feld des Humanen zu verlassen und zur Pflanze zu mutieren – als Dorn im Fleisch der anderen erweist.
Wie kann ein Buch über Gewalt so leise sein? Neuartig? Erhellend, kräftigend? Zunächst: Ist es tatsächlich ein Buch über Gewalt? Ich denke ja. Bereits auf den ersten Seiten, wo der Ehemann der Vegetarierin referiert, warum er genau diese Person zur Frau genommen hat und keine andere, wird im Brustton der selbstverständlichsten Normalität Gewalt eines Menschen über einen anderen ins Spiel gebracht. Meine These lautet denn auch, dass die Autorin in diesem Roman das Leitthema ›Verstörung durch Violenz in menschlichen Verhältnissen und insbesondere in Familien‹ moduliert.
Die zarte Fiktion von Han Kahn kann Verheerungen durch Gewalt bloßlegen – und sie kann mehr. Kräftigen, schrieb ich ein paar Zeilen weiter oben. Was gestärkt wird, wodurch und wozu, erfahren Sie lesend besser selbst.
*******Für Leserinnen und Leser, die auch dann Literatur lesen (also hinschauen aufs Leben), wenn es bitter wird
Michael Fehr: Simelibärg. Roman & Hörspiel. Luzern 2023.
Sebastian Steffen: I wett, i chönnt Französisch. Luzern 2023.
Der gesunde Menschenversand (Nein! Kein Tippfehler, sondern ein Schweizer Verlag) weiß, was er im Fall der beiden Titel macht. Fehr und Steffen haben Potential. Beide Autoren tun sich hervor mit einer je eigenen schweizerischen Sprachverwendung. Sie springen mit den Varietäten der deutschen Sprache um, dass Hören und Sehen vergehen. Diglossie-Erfahrene spüren lesend, wie glücklich sich schätzen kann, wer mit einer doppelten Deutschzunge dem Leben beizukommen versucht.
Beim Bühnenkünstler und Performer Fehr platzt in Simelibärg das Hochdeutsch aus seinen Nähten. Wie ließe sich die Geschichte des millionenschweren alten Landmanns und Spinners, dem offensichtlich der «Sinn zur Selbstverwaltung aus bloßem Bildungsmangel / aus Verwahrlosung / und Krankheit oder sonstigem Irrsinn zu sehr abgeht / als dass man [ihn] auf sich beruhen lassen könnte» (6) und darum die kantonale Fürsorgebehörde zum Zug kommt, in reiner Standardsprache erzählen? Gar nicht. Denn Land und Landschaft, Mensch und Söie gehören in Simelibärg zueinander wie Schwarz und Weiß, Leben und Tod, Krachen und Mars.
Steffens Mundart ist alltagsgerade und zeitgemäß – «Shit, i cha ja gar ke Französisch» (59) – sowie im erzählerischen Zugriff zart, differenziert, einfach wie originell, hart auch und unverschämt. Die Erzählung vom ermordeten Mädchen im Maisfeld entwickelt sich in der Rekonstruktion von Erinnerung im Kopf der Erzählerfigur. In einer einzigen, ausgedehnt kreisenden Klimax fügen sich Szenen, Reflexionen und Bilder zum Schmerzensschrei des überlebenden Quasi-Zwillings und wie nebenbei zur Aufklärung des Verbrechens.
Die Schauplätze sind in beiden Erzählungen unverkennbar schweizerisch: Das Bahnhöfli mit dem Landi-Silo beispielsweise bei Steffens «Buredorf irä Buregängend im Flache» (15), das Bauerndorf mit Hof «in einem Krachen» (5) bei Fehr. Im Flachen und im Krachen tummeln sich Figuren, die man ohne weiteres mit lebendigen Menschen verwechseln könnte.
Fehr und Steffen, diese zwei schon jetzt grandiosen Stimmen auf dem Weg zur Meisterschaft, beleben mit den vorgestellten Titeln garantiert nicht ausschließlich den schweizerischen Literaturbetrieb. Sie werden wohl den Massengeschmack nie bedienen, die Schweizergrenzen aber umso wahrscheinlicher überschreiten. Fehr kultiviert einen archaisch-futuristischen Duktus. Er ist sozusagen der Poet der traditionsbewussten Avantgarde. Steffen hingegen bleibt dezidiert dem regionalen Jetzt zugewandt. Interessanterweise referieren beide Poeten auf das alte Lied ‹Simelibärg› mit seiner S’isch-äbene-Mönsch-uf-Ärde-Melancholie.
******* Fehr für Lesende und Hörende (der Link zum Hörspiel liegt dem Buch bei), die sich von der Düsternis des Ur-Morasts ebenso berühren lassen wie vom kosmischen Licht literarischer Innovation
******Steffen für Interessierte an dialektaler Gegenwartswucht
Han Kang: Weiß. Berlin 2020.
Han ist die Nobelpreisträgerin für Literatur 2024. Die koreanische Autorin, deren Text ›Weiß‹ 2016 in Seoul erschien, legt einen Text vor, über den Katie Kitamura in der New York Times Review (25.02.2019) schrieb: Formal kühn, ergreifend, zutiefst politisch.
Formal kühn ist möglicherweise der von der Autorin in jeder Hinsicht pointierte Minimalismus. Ihr Schreibgestus ist flüchtig, als sollte das Festgehaltene mit dem nächsten Windstoß fortgetragen werden ins unendliche Weiß des Verschwindens, als wiege Druckerschwärze zu schwer für das, worum es geht, als sollte die Materialisierung des Gesehenen und Geschehenen, des Gedachten wie Erkannten mit jedem erneuten Anschlag auf der Tastatur aufgehoben werden. Wenn Literatur meistens über das menschliche Dasein berichtet, wird in diesem Text der Versuch gewagt, Zeugnis abzulegen von ungelebtem Leben, von den Rückseiten des Daseins, der Stille, vom Vergehen auch – und vom Verdrängen, Verschleiern, Wegschauen, Verschwinden lassen des menschlichen Leids. Einheit von Inhalt und Form sind im Ensemble der kurzen Kapitel dieses Buchs stupend. Die Autorin macht schreibend vor, was sie in Frage stellt: Tun, als sei nichts.
Ergreifend und politisch, wie Kitamura in ihrer Rezension attestiert, ist dieser Text von Han Kang tatsächlich. Individuen und Gemeinschaften verwenden eine schier unermessliche Energie darauf, ihre Zerbrechlichkeit und Zerbrochenheit zu verschleiern. Wie menschlich! Wie hilflos! «Daher bleiben noch ein paar Dinge […] zu tun: Mit dem Lügen aufzuhören. Ihre Augen zu öffnen und den Schleier wegzuziehen.» (S. 126f.)
Sterne vergeben? Inadäquat. Das Buch ist für alle Lesenden lesenswert, die neugierig auf fremd anmutende Texte sind.
Caroline Wahl: 22 Bahnen. Köln 2023.
In den 80-er Jahren des letzten Jahrhunderts ist es u.a. Ulrich Plenzdorf gelungen, Stimmen von unten, die gleichzeitig Stimmen der damaligen Gegenwart waren, in der deutschen Literatur zu etablieren. Menschen vom Rand der Gesellschaft – beispielsweise ein Hilfsschüler in «Kein runter kein fern» (1984) – monologisieren und erzählen. Wenig beachtete Blickwinkel, Erlebnisweisen, Handlungen, Mindsets und Sprachverwendungen brechen sich Bahn, und das mit Wucht und Kunstverstand.
Die literarischen Bahnen von Caroline Wahl erinnern an Plenzdorfs poetische Milieustudien. Deutsche Verhältnisse auch bei Wahl, nun im Jahr 2023 in einem Dreipersonenhaushalt: Eine Mutter und zwei Töchter. Die ältere Tochter Tilda, eine hochbegabte Studentin, sorgt für alle drei, denn die Mutter ist Alkoholikerin und die jüngere Schwester auf den ersten Blick und in den ersten Jahren zu jung, um mit zu schultern. Erzählend führt Tilda durch Tage, Wochen und Jahre eines Lebenskampfes. Die junge Frau und das Mädchen Ida ringen täglich um das, was die prekären Verhältnisse an Leben hergeben. Das braucht mit und neben der suchtkranken Mutter herkulische Kräfte und Intelligenz. Es entfaltet sich denn auch ein Heldinnenepos, wie die Erzählerin im Roman persönlich expliziert: «Das hier sollte nie eine Liebesgeschichte werden. Das sollte wenn, dann Idas und meine, vor allem Idas Heldinnengeschichte werden, in der sich Ida von Mama befreit. Aber andererseits. Was ist ein Heldenepos ohne Liebe?» (Taschenbuchausgabe S. 188) Tatsächlich überraschen, rühren, berühren, inspirieren die Lesenden beide, die Heldinnen- und die Liebesgeschichte. Was Heldendichtung seit je tat, löst dieser Erstling einer begabten jungen Autorin ganz neu ein: Sie berichtet von Ereignissen und Handlungen, die sich für die Entwicklung einer Gemeinschaft als bedeutsam erweisen. Caroline Wahl orgelt das tradierte Heldenleben-Schema nicht durch. Klug fokussiert sie auf die Elemente der gefährdeten Jugend und der Such-Fahrt. Ganze Heldinnen sind ihre beiden Figuren Tilda und Ida auch so.
******* Ob sich Menschen für Heldinnendichtung des 21. Jahrhunderts erwärmen können?
PS: Caroline Wahl: Windstärke 17. Köln 2024.
Ich hätte mir gewünscht, dass die Autorin einen weiteren künstlerischen Weg bis zu ihrem zweiten Roman gegangen wäre.
Sara Nisha Adams: The Twilight Garden. London 2023.
Liebe, Freundschaft, Familie, Nachbarschaft im großstädtischen und multikulturellen Zusammenhang – wie geht all das? Die junge Londoner Autorin Sara Nisha Adams untersucht exakt diese uralten Phänomene und erzählt hinreißend einfach von der Bedeutung, Wirksamkeit, Fragilität und Resistenz der sozialen Verbundenheit in ihren vielfältigen heutigen Erscheinungsformen im urbanen Westeuropa. Wie in ihrem ersten Roman (The Reading List, siehe Lektürejournal 2023) spielen auch in ihrem zweiten Orte außerhalb der privaten vier Wände eine zentrale Rolle. Ein verwilderter Stadtgarten erweist sich als Auge des Beziehungssturms. Hier, in der Sphäre von Wachstum und Stillstand im Jahreszeitenzyklus, also so langsam wie überraschend, gedeiht auch die Konnektivität zwischen Generationen, Tieren und Menschen, Eingesessenen und Neuankömmlingen. Es pulsiert ein diverser Oikos, der den Gesetzen der Natur unterworfen und gleichzeitig dezidiert von Menschen gestaltet ist.
Adams ist eine Meisterin der dynamischen, komplexen und offenen Figur. Leserinnen und Lesern fällt es leicht, das Personal der erzählten Welt zu lebendigen Personen zu komplettieren, die (eine oft unbekannte) Geschichte haben, atmen, feiern, lernen, kämpfen, stagnieren, sich weiterentwickeln, sterben. Und noch etwas ist bemerkenswert: Die Figurenkonstellation im Roman kommt ohne Bösewichte aus und ist doch spannungsvoll und nichts weniger als kitschige Idylle. Warum? Die Autorin interessiert sich für und fokussiert auf das, was Menschen verbindet und was sie wachsen lässt – und zwar überall auf der Welt, im Londoner Stadtgarten ebenso wie in Indien oder in Afrika. Adams schöpft dabei aus einem Repertoire an Verhaltens- und Reflexionsweisen, an Ausdrucksmöglichkeiten und Kommunikationsmodalitäten, an Beziehungskonventionen und -ritualen, das seinen Reichtum ihrer stupenden Beobachtungsgabe und überdies wohl der Erfahrung von Multikulturalität in der eigenen Familie verdankt.
Über Adams Fiktion erweitert sich die Sicht auf humane Formen der Verbundenheit. Das ist ausgesprochen wertvoll, zumal sich Fiktion gern dem Konkreten, Unverwechselbaren, Unsichtbaren (beispielsweise der Innenwelt einer Figur) zuwendet. Ein Beispiel: Winston, ein aus Indien nach London emigrierter junger Wirtschaftsexperte, schafft es nicht, seine kranke Mutter vor ihrem Tod zu besuchen. «If he went, it meant it was real. He wanted to believe she was still there, living her life in India.» (S. 211) Der Kummer über den Verlust und über seine Unfähigkeit, den Tod der geliebten Mutter mit eigenen Augen zu sehen, zermürben ihn. Er verschließt diesen Schmerz in sich und entwickelt in der Folge Distanz zu seinen wichtigen Menschen in London. So aufschlussreich und wichtig wie Winstons Problemlage sind im Roman viele andere. Wie sich die Problemlagen verändern können, auch.
*****Für alle, die immer wieder über das Wachsen von Menschen (und Pflanzen) staunen
Kim de l‘Horizon: Blutbuch. Köln 2022.
Im Blutbuch von Kim de l’Horizon ertastet ein Erzähler-Ich seine Sprachen, Stimmen, Formen, seine Schreib- und Lebensmöglichkeiten. Nicht überraschend: Das Suchen ist De l‘Horizons Thema. Das Ertasten, Auffinden des Gegebenen und gleichzeitig das Generieren, also auch Gewinnen von (neuer) Wirklichkeit. «Wirklichkeit ist nicht, Wirklichkeit will gesucht und gewonnen sein», sagte Paul Celan 1958 (Celan, Gesammelte Werke in fünf Bänden, Frankfurt am Main, 1983, Band III, S. 167) und betonte damit jene zwei Seiten der Faktenorientierung, die auch De l‘ Horizon interessieren. «Wirklichkeitswund» (noch einmal Paul Celan, ebd. S. 186) kniet sich das erzählende Ich ins Milieu seiner Erinnerungen und seiner Gegenwart hinein. Leserinnen und Leser erleben die Erzählinstanz, die gleichzeitig die Stimme der Zentralfigur des Buches ist, als hochsensibles Kind – das bei Mutter und Großmutter in einer schweizerischen Agglomerationsgemeinde aufwächst – und zudem als junge erwachsene Person mit der doppelten Geschlechtsidentität von Frau und Mann und dem unbedingten Willen, Wirklichkeit sprachlich zu greifen.
Wo also Gegebenes und zu Gewinnendes ertasten? Einerseits in der Gegenwart der jungen erwachsenen Zentralfigur. Sie schreibt auf, was passiert, wie es sich anfühlt, was wahrnehmbar und erinnerungsfähig ist, was umtreibt. Andererseits arbeitet sie sich durch die verschiedenartigsten Archive. Sie öffnet das eigene Erinnerungsarchiv sowie die Erinnerungsarchive der Großmutter und Mutter; sie arbeitet mit Elementen der persönlichen Wissensarchive des erwähnten Dreiergespanns; sie reflektiert, wie die persönlichen Archive alimentiert bzw. überwölbt sind vom historischen Archiv der allgemeinen Kulturbestände.
Wie das Erfasste darstellen? Klar, mutig, skeptisch, zart, derb, unorthodox – unter Aufbietung mehrerer Sprachen, Erzählweisen und typografischen Darstellungsarten. Die schweizerische Diglossie, das patrizische Französisch und das zeitgenössische Englisch erweisen sich je nach Kontext als passende Ressource. Aus innerem Dialog und Monolog, Brief, Erzählbericht, aus Dokument und Reportage entwickelt sich montiert ein komplexes und einzigartiges Erzählprofil.
Wozu obsessiv suchen und schreiben? Innerhalb der erzählten Welt geht es wohl unter anderem um Selbstvergewisserung. «Ich bin da, mein Herz schlägt.» (Simone de Beauvoir) Genereller betrachtet steht fest, dass das Narrativ von Welt und Wirklichkeit durch jede einzelne literarische Stimme, die diesen Namen verdient, aufgebrochen und erweitert wird. Kim de l’Horizons Stimme(n) tun in diesem konzentrierten Buch genau das.
***** Mindestens für alle, die Kim de l’Horizon ausschließlich medial vermittelt kennen
David Foster Wallace: This is Water. New York, Boston, London 2009.
Die beiden großen amerikanischen Autoren David Foster Wallace und Jonathan Franzen waren Freunde. Von beiden liegt eine Rede vor, die sie anlässlich einer Graduiertenfeier an junge Akademikerinnen und Akademiker adressierten. Franzens Rede habe ich im Lektürejournal 2022 besprochen und die Rede von Wallace erst jetzt entdeckt: This is Water. Diese erwachsene Stimme! Sie ist bereits verstummt. Wallace ist 2008 in einer Depression dem Leben erlegen. Franzen schreibt in seinen Notizen zum Tod des Freundes: «He’d gone down in the well of infinitive sadness […] and he didn’t make it out. But he had a beautiful, yearning innocence, and he was trying.» (Franzen, Farther Away, 2013)
Nun zu Wallace‘ Rede: Ausgehend von wiederholt zitierten Phrasen anlässlich von Graduiertenfeiern – beispielsweise: es gehe in der geisteswissenschaftlichen Bildung nie ausschließlich darum, positives Wissen anzuhäufen, vielmehr darum, denken zu lernen – entwickelt Wallace in stupender Klarheit, was solche Bildungsprinzipien im Amerika der Nullerjahre bedeuten und was sie einem gebildeten Erwachsenen abverlangen. Die Stringenz seiner Konkretisierungen, seine Strenge im Nachfragen, worum es in tradierten Clichés der Akademie geht, seine Verweigerung, vor den jungen Menschen den Moralfinger oder die Tugendfahnen zu bemühen, seine Ehrlichkeit hinsichtlich der erlebten und erlittenen Erwachsenenwelt erzeugen eine geistige Atmosphäre der Verbindlichkeit, Überraschung und Inspiration. Mehr noch. Die bereits im Jahr 2005 gehaltene Rede ist heute und hier aktuell. Denn im Kürzestformat einer Ansprache stellt und beantwortet Wallace die zentralen Fragen, welches Denken gelehrt bzw. gelernt werden muss, welches Wissen hilfreich ist, welche Freiheit erarbeitet sein will, wenn es darum geht, das menschliche «defaut setting» (basic self-centeredness) im alltäglichen Erwachsenenleben zu korrigieren. Dieser brillante Intellektuelle war unfassbar mutig und sympathisch. Darum ein einziges Mal seine originale Stimme: «The really important kind of freedom involve attention, and awareness, and discipline, and effort, and being able truly to care about other people and to sacrifice for them, over and over, in myriad petty little unsexy ways, every day. […] I know that this stuff probably doesn’t sound fun and breezy or grandly inspirational the way a commencement speech’s central stuff should sound. What it is, so far as I can see, is the truth, with a whole lot of rhetorical bullshit pared away.»
******* Pflichtlektüre für alle Hochschullehrerinnen und -lehrer
Bonnie Garmus: Lessons in Chemistry. London 2022.
Gelegentlich misstraue ich meinem Urteilsvermögen, was Romane angeht. Es dürfte überzufällig sein, dass es sich in Momenten des Zweifels immer um englische Romane und, ach ach!, meistens um Bestseller handelt. Ist die Germanistin schlicht hingerissen vom fremden Idiom? Erscheinen Witz, Tempo, narrative Hintertreppen glanzvoller, weil sie rein sprachlich im Kopf der Kritikerin noch nicht tausendfach abgeschritten sind? Und: Können Bestseller literarisch etwas taugen?
Wie dem auch sei. Bonnie Garmus ist lesenswert. Sie erzählt in ihrem Erstling mit dem menschenfreundlichsten Furor von Sexismus – und Leserinnen und Leser widmen sich zugleich haareraufend und lächelnd wieder einmal der hinlänglich bekannten Frage, ob der homo sapiens wohl je in seine ihm lächerlich (zu) große Krone hineinwachsen werde. Wie gelingt dieses Doppelte? Wodurch schafft es Bonnie Garmus, unbedingte Dringlichkeit gegenüber dem durch fehlgeleitete Geschlechtsstereotypen verursachten Leiden zu evozieren und gleichzeitig die Lust am Konzept einer lebhaften Geschlechtsidentität zu zelebrieren? Natürlich ist ein ganzes Bündel an Kunstgriffen sichtbar. Ich nenne nur einen der wichtigsten. Bonnie Garmus‘ erzählte Welt ist betont artifiziell: Vom durchkomponierten, pointierten, reduzierten Plot bis zur Erzählerstimme eines Hundes ist alles überdeutliche Fiktion, was im Falle dieses Romans auch heißt: Dem Möglichkeitssinn wird neben dem Wirklichkeitssinn hohe Bedeutung zugemessen. So wird die Reihe der gewaltsamen sexistischen Einzelphänomene weder je lamentierend noch räsonierend noch verurteilend kommentiert, sondern schlicht kontrastiert. Der sexistische Habitus ist in der erzählten Welt der 60-er Jahre des 20. Jahrhunderts allgegenwärtig, aber kein (Natur)Gesetz – männliche und weibliche Figuren und selbst eine Kinderfigur durchschauen, widerstehen, wehren sich, erfinden, lügen, schummeln, straucheln, verzweifeln, kämpfen, beharren und gewinnen.
Die Autorin ist sehr klug. Weder verharmlost sie das Leiden noch verliert sie sich darin. Auch stattet sie die Opfer des Sexismus in ihrem Roman nicht mit übermenschlichen Kräften aus. Menschliche reichen völlig aus, um positive Veränderungen anzustoßen.
****** Für alle, die den von guter Literatur ausgehenden Appell „Du musst dein Leben ändern!“ selbst einem Bestseller zugestehen
Lektürejournal 2023
Dieter Thomä: Warum Demokratien Helden brauchen. Plädoyer für einen zeitgemäßen Heroismus. Berlin 2019.
Zahlreiche Menschen in der westlichen Welt sind kollektiv fassungslos. Die Demokratie ist als politische Ordnung aktuell nicht nur von antidemokratischen Kriegstreibern und Autokraten, sondern zunehmend auch von demokratieverdrossenen Bürgerinnen und Bürgern bedroht. Die »unordentliche Ordnung«, wie Dieter Thomä das demokratische System treffend charakterisiert, steht tatsächlich zur Debatte. Die beiden Seiten der Demokratie einerseits im Respekt vor dem rechtsstaatlichen Regelapparat wie andererseits im Suchen nach und Kämpfen für neue Wege hochzuhalten, gleichzeitig also verfassungstreu und bewegt zu sein, ist kein politisches Kinderspiel und war es nie. Soviel steht für den Autor mit seinem historischen Weitblick fest. Schaffen Normalsterbliche es also nicht, den Anforderungen des demokratischen Systems zu genügen – müssen Heldinnen und Helden übernehmen? Was zunächst unsympathisch rückwärtsgewandt klingt, erweist sich in Thomäs Studie als hoch aktuelles Empowerment.
Zeitgemäße demokratische Heldinnen und Helden kommen aus der Mitte der Gesellschaft und stellen sich für eben diese Gesellschaft ohne Rücksicht auf eigene Verluste in den Wind. Als der großen Sache »unordentliche Ordnung« Verpflichtete zeigen sie mit ihrem Handeln auf, was in der aktuellen politischen Lage Priorität hat oder was an Veränderungen nötig und möglich ist. Weil sie selbstvergessen handeln, ist ihr Herausragen aus der demokratischen Gesellschaft nicht nur bewundernswert wie beispielsweise das Herausragen von Hochleistungssportlerinnen und überragenden Leistungsträgern in anderen gesellschaftlichen Feldern. Ihr Handeln aktiviert die Normalsterblichen. Es inspiriert zum Aufstehen und Eintreten für jene große Sache, die die demokratische Community mit dem Helden oder der Heldin verbindet: für die Freiheit der Menschen, für ihre politische Selbstbestimmung, für die sich wandelnde Demokratie. Rosa Parks (1913 – 2005, USA) verkörpert eine Spielart des demokratischen Heroismus, indem sie sich als schwarze Frau 1955 weigerte, ihren Sitzplatz im Bus für einen weißen Fahrgast zu räumen. Es geht um diese entschlossene Größe, die den Heldinnen und Helden im entscheidenden Moment eher zufällt, als dass sie ein Persönlichkeitsmerkmal wäre, und die die Zeitgenossinnen und Zeitgenossen für die demokratische Arbeit aufweckt.
***** Das Plädoyer, um ca. hundert Seiten gekürzt, empfehle ich allen Demokratinnen und Demokraten zur Lektüre vor wichtigen Wahlen
Christine Olmos: Logbuch. Notate. Bern 2023.
Ob man sich für Schicksalsschläge wappnen kann? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, wie Worte tragen können und zuweilen noch mehr: durchtragen können. Das Logbuch von Christine Olmos ist in mehreren Hinsichten tragfähig. Bereits die Textsortenhinweise im Doppeltitel «Logbuch. Notate» machen klar, wie sich die artikulierte Stimme im Buch dem widmen und stellen will, was passiert. Die Facetten einer Navigation durch unbekanntes Gelände sollen aufgezeichnet und archiviert werden, «Mich festhalten an den Wörtern, bis es tropft / bis das Eis schmilzt von der Eisfaust / und der Würgeengel die Flügel hebt» (18). Wenn eine Frau zwei Krebsdiagnosen entgegennehmen und sowohl die Krankheit als auch die Therapien durchleiden muss, wird alles neu vermessen. Räume, Zeit, Tempi, der Körper, Bedürfnisse, Schmerzen, Glück und Angst, das Ich, Wissen, Ahnungen, Träume, Erinnerungen, Perspektiven, Beziehungen, Natur und Kultur, Krankheit und Tod und Genesung. Verlässlich zur Verfügung steht für eine solche Reise das Log, ursprünglich ein nautisches Messgerät zum Erfassen der wichtigsten Parameter einer Seefahrt, im Fall der Fahrt durch eine neue Wirklichkeit die Sprache, die sich jedoch, anders als das technische Vermessungsinstrument, durch neue Erfahrungen laufend auch selbst erneuert.
Olmos‘ Sprache ist denn auch facettenreich wie die Inhalte, dabei immer verbindlich und auf jeder Ebene der aufgezeichneten Erfahrung faktenorientiert minimalistisch, ein Logbuch eben. Mal greift sie messerscharf, mal zart oder sogar verspielt, dann auch suchend und stets kraftvoll.
Das Logbuch gehört zu den Textsorten, die verordnet geschrieben werden – sie müssen geführt werden und die verantwortliche Person des gegebenen Kontextes unterschreibt die Einträge. Auch das passt. Allerdings gibt es keine externe Autorität, die die Aufzeichnungen anordnen und als wahrheitsgetreu abzeichnen würde. Es gibt allein das Ich, das schreiben und unterschreiben muss, nichts anderes, niemand anderes.
****** Für reifere Semester
Sara Nisha Adams: The Reading List. London 2021.
Adams stemmt Gegenwart. Sie tut das mit einer selbstverständlichen Leichtigkeit, die fast vergessen lässt, wie unfassbar schwierig es ist, im Strom des Lebens stehend exakt diesen überkomplexen Strom narrativ zu bändigen. Wenn ich sage überkomplexer aktueller Kontext, geht es ums Leben im multikulturellen, plurilingualen London der Zwanzigerjahre des 21. Jahrhunderts. Im London des Informationszeitalters.
Auf der Folie des Grossstadt-Getöses zoomt die Autorin über ihre Protagonisten, über Schauplätze und Aktivitäten Lebensausschnitte der Stille heran: Die Einsamkeiten eines älteren Witwers der indisch-kenianischen Community und einer Jugendlichen im Schatten der psychischen Krankheit ihrer Mutter; die Bibliothek; das Lesen von Literatur. Ausgehend von diesen ganz und gar unterschiedlichen (und nur vermeintlichen) Stillstands-Phänomenen legt die Autorin Lebenssituationen ihrer Figuren frei und verbindet sie, die Lebenssituationen, aber auch sie, die Figuren, mit fiktionalem Leben aus der Literatur, die die Protagonisten lesen.
In der erzählten Welt spielen also das Lesen von Literatur und die erzählten Welten der gelesenen Werke eine Schlüsselrolle. Dieses Verfahren der literarischen Potenzierung ist uralt – und bei Sara Nisha Adams blutjung. Literatur ist in ihrer Welt im Zeitalter der Digitalisierung nicht bildungsbürgerliches Sahnehäubchen, sondern herzzerreissend wichtig.
***** Für alle, aber vor allem für junge Menschen
Julia Schoch: Das Liebespaar des Jahrhunderts. Biographie einer Frau. München 2023.
Selten ist der Titel eines Romans informierend und aufregend zugleich. Noch seltener hält ein Titel, was er großmäulig verspricht. Schoch gelingt das Besondere: Ihr Liebespaar reiht sich ein in die Paare der vergangenen Jahrhunderte deutscher Literatur. Mit Tristan und Isolde begann einst der Reigen der zeittypischen Liebespaare, mit dem Du und Ich in Schochs Roman aus dem 21. Jahrhundert endet er vorläufig – viele werden kommen, wenige so unvergesslich und wirkmächtig sein wie die beiden genannten. Die Liebe ist ja bekanntlich das ewige Thema der Literatur schlechthin, die Geschichten der Paare aber sind, was alle wissen und mit diesem Roman neu erfahren, ganz und gar zeitgebunden.
Schochs Paar wird nicht nur aus der Perspektive der Frau gezeichnet, die Frau ist auch die sich erinnernde, suchende, zweifelnde Erzählstimme. Bereits diese Konstellation ist unverkennbar zeitgemäß. Die Eckpunkte der Liebes-Erzählung sind deshalb den Zeitgenossinnen und Zeitgenossen nur allzu vertraut: Das Paar ist aus emanzipatorischen Gründen nicht verheiratet; beide sind erwerbstätig und wirtschaftlich unabhängig; die Kinder sind gewolltes Projekt beider Liebender; das gemeinsam verfasste Liebesmanifest ist so nüchtern («Auf das Gefühl ist wenig Verlass«) wie emphatisch («Verschwende dich nicht an eine fade Liebe»). Eine heterosexuelle Liebe auf Augenhöhe der Geschlechter - das scheint es auf den ersten Blick zu sein.
Warum tut es denn weh, die Geschichte dieses tadellos aufgeklärten Paares zu lesen? Womöglich weil die Frau und Erzählerin und Dokumentalistin der Jahrhundertliebe die Last der Reflexion dessen, was sich in einer lange dauernden Paarbeziehung abspielt, ganz alleine trägt. Und mehr noch: Weil sie am Ende des wahrhaft ernüchternden Protokolls in einem euphemistischen Turn ihr alltägliches Leiden in zweifelnder Vorsicht und doch unmissverständlich zu dem erklärt, «was man ein erfülltes Leben nennt.»
******* Für Menschen, die sich nicht an fade Romane verschwenden wollen
Robert Seethaler: Das Café ohne Namen. Berlin 2023.
Seethaler – was für ein Zeitgenosse und Autor! Sein Erzähler ist ganz und gar aus der Zeit gefallen. Globalisierung und Digitalisierung sind in seinen erzählten Welten Lichtjahre entfernt. Im neuen Roman werden die Nachkriegsjahre des zwanzigsten Jahrhunderts in Wien vergegenwärtigt, und zwar aus der Sicht der Alltagskämpfer. Protagonist ist der Gelegenheitsarbeiter Robert Simon, der mit dem «Café ohne Namen» einen Ort schafft für Menschen ohne Namen oder besser, für Menschen mit einem ungepolsterten Leben.
Seethalers Figuren treten im Oikos des Cafés und seiner Umgebung auf wie erbärmliche Lichtgestalten, die die Trümmerwelt der Nachkriegsjahre humanisieren. Ihre Würde manifestiert sich in der Einzigartigkeit ihres Lebenskampfes. Seethaler, der Meister des erzählerischen Alltagsfokus, bringt zur Darstellung, was nicht erzählenswert, weil nicht ereignishaft und großartig und tragisch erscheint. Alles ist nur furchtbar wahr. Wie kann man den Lauf der Zeit und das Leben von Figuren ohne Wehklagen und ohne jubelnde Übertreibung so festhalten, dass im erzählten Staub der Gosse, im Mief der Armut, im Jammer des Alters und der Krankheiten, im Schatten der Erschöpfung das Wunder des sozialen Miteinanders aufleuchtet?
****** Für Literatur- und Kunstwissenschaftlerinnen eine Goldgrube, für sensible Leser ein Ereignis
Damon Galgut: The Promise. Dublin 2022.
Galgut strukturiert seinen Roman nach Begräbnissen. Es sind deren vier: Mutter, Vater, die älteste Tochter und der einzige Sohn einer fünfköpfigen weißen Familie werden in dieser Reihenfolge (und immer nach mehrjähriger Zwischenzeit ohne Tod in der Familie) zu Grabe getragen – und jedes Mal versammelt sich der hinterbliebene Clan auf dem Gut der Familie im südafrikanischen Highveld.
So einfach wie die Architektur der erzählten Welt ist in diesem brillanten Gesellschaftsroman sonst gar nichts. Innerhalb der vier Kapitel (Ma, Pa, Astrid, Anton) bewegt sich die Erzählerstimme wie ein Irrlicht im Leben der Protagonisten, nimmt im schnellen Wechsel unterschiedliche Perspektiven ein, vergibt Informationen zur Vergangenheit und zur Gegenwart, zum gesellschaftlichen und politischen Kontext in Südafrika, zu biografischen Ereignissen sowie zur Innenwelt der Figuren. Insgesamt werden die Lesenden konfrontiert mit einer fiebrigen und zugleich luziden Art des Erzählens, die der Wahrnehmung von Leben in der realen Welt nicht allzu unähnlich ist. Ähnlich ist insbesondere der schnelle Takt des Doppelfokus, das heißt, die intime Nähe zu Situationen und Details im Wechsel mit dem schweifenden Blick in diverseste Weiten hinaus.
Amor überlebt. Die jüngste Schwester ist im ersten Kapitel ein Teenager und am Schluss des Romans Mitte vierzig. Sie ist die stille Zeugin dessen, was sich an Veränderung in einem halben Menschenleben zutragen kann.
***** Für alle, die mehr von der (südafrikanischen) Welt wissen wollen
Annie Ernaux: Eine Frau. Berlin 2020. [Paris 1987].
Schreiben ist Leben und gelegentlich Weiterleben. Die französische Grande Dame der Autofiktion legt mit dem Text über ihre – zum Zeitpunkt des Schreibprozesses verstorbene – Mutter ein poetisches Protokoll eben dieser Erfahrung vor. In eine Reihenfolge bringen, was das Leben der Frau, die die eigene Mutter war, bedeutet hat, ist eine Conditio sine qua non fürs Weitergehen der Tochter. Die unbedingte Konzentration, mit der die Autorin porträtiert, steht für den Respekt vor dem Leben der Frau, die eine Generation vor ihr und deshalb auch in anderen Umständen ein Frauenleben entworfen, gestaltet, erhofft, genossen und durchlitten hat. Dass die Schreibende selbst Teil dieses Lebens war, erweist sich als jene hinlänglich bekannte Schwierigkeit, die autofiktionales Erzählen auszeichnet und im besten Fall interessant macht.
Bemerkenswert ist bei diesem Text, wie eng verbunden und unfassbar getrennt die beiden Frauenleben sind, die notwendigerweise zur Sprache gebracht werden, wenn eine Tochter über ihre Mutter schreibt. Ernaux‘ Strategie, der Distanz mehr Raum zu geben als der Nähe, was der Titel mit dem unbestimmten Artikel und dem Verzicht auf eine Verwandtschaftsbezeichnung antizipiert, generiert einerseits die erschütternde Erkenntnis, wie hilfsbedürftig jede Generation ist und wie weitgehend hilflos sie dem Leiden der anderen Generation begegnet. Andererseits wird exakt damit auch eine Atmosphäre des Stolzes, der Würde und der Freiheit konzipiert. In stupender Art und Weise zeigt sich die Kraft von Mutter und Tochter, ihr ganz einzigartiges Leben zu leben und, im Falle der Mutter, auch die Kraft zu sterben.
***** Für Skeptikerinnen und Skeptiker der autofiktionalen Welle in der neuesten Literaturgeschichte
Irina Kilimnik: Sommer in Odessa. Zürich und Berlin 2023.
Wer sich an Titeln ergötzt, wird den Kilimnik Roman gar nicht zur Hand nehmen, zumal «Sommer in…» im Jahr 2023 die gefühlt häufigste Variante der seicht-romantischen TV-Filme mit globalem Lokalkolorit ankündet. Nur: Im Europa 2023 beansprucht «… in Odessa» hingegen unbedingte Aufmerksamkeit. Wann gewährt die erzählte Welt einen Blick auf bzw. in die Stadt am Schwarzen Meer? Vor der russischen Invasion in die Ukraine, während ihr oder gar nach ihr?
Es geht um den Sommer unmittelbar nach der russischen Annexion der Krim 2014. Die in Berlin lebende Autorin erzählt in angenehm raschem Tempo von einer klugen jungen Frau, Studentin, Tochter, Schwester, Nichte, Enkelin, Cousine, Freundin, Geliebten in eben diesen Rollen. Wie Rollenerwartungen erfüllt und enttäuscht werden, wie gewichtig diese Erwartungen im jungen Erwachsenenalter zu sein scheinen und wie allgegenwärtig sie in einem Mehrgenerationenhaushalt wirksam sind, ist unterhaltsam und sensibel in Szene gesetzt. Die Perspektive der Protagonistin (be)rührt. Diese Kraft und Verletzlichkeit der Jugend!
Kilimnik kann Milieus, Stimmen, Stimmungen großartig versprachlichen, was für einen Roman durchaus genügt. Die Story muss nicht angereichert werden mit einem Familiengeheimnis. Im Gegenteil. Das erzählerisch konstituierte System Großfamilie wird durch den ach so lange verschwiegenen Bastard des Großvaters und Tyrannen eher banalisiert/konventionalisiert als profiliert. Dass und wie die politischen Spannungen im Roman skizzenhaft bleiben, ist hingegen ein Gewinn.
*** Für alle, die ein Ein-Sommer-in-Buch zehn Sommer-in-Filmen vorziehen
Anna-Lisa Dieter: Susan Sontag. 100 Seiten. Stuttgart 2022.
Den Reclam-Verlag habe ich schon immer gemocht: Das kleine Format, die Farbe, das Papier – und natürlich und vorab den Sinn für Qualität. Kein modischer Verlag, wie wir alle wissen. In der Reihe «100 Seiten» legt Dieter ein schnelles und helles Porträt der amerikanischen Publizistin Susan Sontag vor. Für einmal durchaus modisch. Man liest die hundert Seiten vorzugsweise im Intercity oder in der Abflughalle, denn sie bewegen und machen Lust auf ein Take Off. Die jüngste Geistes- und Zeitgeschichte brummt in der Vergegenwärtigung der 2004 verstorbenen Autorin und ihrer Schriften.
Dieter fokussiert klug auf ein einziges Gestaltungsprinzip (Listen und Tabellen) und auf ein einziges Genre im Sontag-Kosmos (Essay). Überraschend erzählen die abgedruckten Listen ohne falsche Bewunderung von der hochbegabten Frau und ihrer Entwicklung, während die Präsentation und Kommentierung einiger bahnbrechender Thesen aus ausgewählten Essays Sontags sensible und gleichzeitig fordernde Reaktionen auf gesellschaftliche Gemengelagen erhellen. Zu abstrakt? Ein Beispiel muss genügen: Die in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts brisante Dichotomie ‚Hoch- bzw. Populärkultur‘ – mit dem damals noch weit verbreiteten Urteil, nur Hochkultur sei Kultur für ernstzunehmende Zeitgenossinnen und Zeitgenossen – stellte Sontag mit dem Begriff ‚Camp‘ (se camper, frz: posieren) in Frage und erreichte damit, verkürzt gesagt, dass neben den Qualitäten des bildungsbürgerlichen Kanons im Kulturbetrieb ins Blickfeld geriet, was bis anhin als Trash galt bzw. als Un-Kunst ignoriert wurde. Ein überfälliger erweiternder und befreiender Blick, zumal Sontag darauf beharrte, die Qualitäten der High-Brow-Werke weiterhin hochzuhalten.
**** Für Liebhaberinnen und Liebhaber von Essays, die die Welt verändern
Audrey Magee: The Colony. London 2022.
Thematisch innovative literarische Stimmen gibt es im Moment auf dem Büchermarkt zuhauf. Seltener kommt es vor, dass eine noch unbekannte Stimme auch literarisch Neues und Bemerkenswertes präsentiert. Audrey Magee tut das. Ihr Roman ist ein Kammerspiel mit wenig Personal, einem auf den ersten Blick idyllischen Schauplatz und einem einfachen Handlungsbogen. Insgesamt präsentiert sie eine unspektakulär natürliche erzählte Welt.
Eine kleine, dem irischen Mainland vorgelagerte Insel wird in den Sommermonaten von zwei Fremden besucht. Der englische Kunstmaler Lloyd hofft, in der insularen Abgeschiedenheit sein Masterpiece zustande zu bringen, und der französische Linguist Masson will seine Studie zum Wandel der irischen Sprache beenden. Was der Titel des Buchs nahelegt, findet tatsächlich statt: Zwei Männer kolonialisieren im Laufe des erzählten Sommers die Bewohnerinnen und Bewohner der Insel, was, nicht überraschend, auch hoch problematische Konsequenzen hat.
Magee erzählt konzentriert, lakonisch, minimalistisch und variantenreich vom Pulsschlag der Gewalt in Geschichte und Gegenwart. Mit dem kalten Licht der sprachlichen Zurückhaltung leuchtet sie die Spur der Zerstörung und Verheerung durch Gewalt in verschiedenen historisch-politischen Situationen (unter anderen im englisch-irischen Konflikt der verschiedenen Jahrhunderte) sowie in unterschiedlichsten gesellschaftlichen und individuellen Kontexten aus. Dass sie sich vom «Irischen Tagebuch» (Heinrich Böll, 1961) inspirieren liess, ist für intertextuelle Recherchen besonders anregend.
****** Meisterhafte literarische Reduktion für literarisch und politisch Interessierte
Lektürejournal 2022
Jonathan Franzen: Farther Away. New York 2012. [dt.: Weiter weg]
Mein Buch des Jahres 2022 habe ich im Mai in New York gekauft. Franzen kannte ich bereits als grossen Romanschreiber. Gerade hatte ich seinen jüngsten Wurf «Crossroads» gelesen und packte darum bei seinen Essays zu – elektrisiert bereits vom ersten Titel der Sammlung: «Pain won’t kill you», [commencement address, Kenyon College, May 2011]. Gelegenheitsliteratur also: Eine Rede zur Abschlussfeier von College-Studierenden.
Ein Schriftsteller mit Format betet an einer akademischen Abschlussfeier keine Systemkritik, keine Zukunftswünsche, keine gesamtgesellschaftlichen Visionen herunter. Vielmehr spricht er von sich selbst: „I’m going to do what literary writers do, which is to talk about themselves, in the hope that my experience has some resonance with your own.“ Dass sich diese seine Hoffnung erfüllt, hat nicht nur, aber auch damit zu tun, wie messerscharf Franzen vor den jungen Leuten von einem hochkomplexen, schwierigen und zentralen Thema spricht: von der Liebe nämlich. In nie dagewesener humorvoller Klarheit entfaltet sich in seinem Erzählen von der konsumorientierten Kultur des «Likens» eine Vorstellung dessen, was im Leben der Menschen eine Kultur des «Liebens» bedeuten könnte. Wie ernst es ihm mit dem Plädoyer für die Liebe («love») ist, zeigen seine konkreten Aussagen darüber, was Liebe auszeichnet, was sie bewirkt, was sie mit sich bringt und wohin sie führen kann. Liebe, wie Franzen sie versteht, geht einher mit bodenloser Empathie und der plötzlichen Erkenntnis, dass der, die oder das Andere in jeder Hinsicht so real und so einzigartig ist wie man selbst. Sie reisst den Blick weg von der eigenen Person zur fremden Realität, sie katapultiert die Liebenden runter vom Sofa und vom generellen Leiden an der Welt hinein in die Aktion für ein konkretes, spezifisches, einzigartiges Gegenüber. Der selbstverständliche Einsatz für das, was man liebt, unterscheidet Liebe vom konsumistischen Projekt des stets selbstbezogenen und darum die Person korrumpierenden Likens.
Franzen kommt in seiner Rede ohne Gedöns und ohne jegliches Anbiedern an sein junges Publikum aus. Seine intellektuelle und emotionale Redlichkeit reicht aus, um in den Köpfen der Zuhörerinnen und Leser die Liebe als sinnstiftendes Moment des Lebens zu inthronisieren und alle auf die Suche nach ihr zu schicken. Liebe tut zwar im Unterschied zum Liken weh, gelegentlich und unvermeidlich, aber, sagt er, «Pain won’t kill you».
Wie weit Franzens „love and pain stuff“ führt, erfahren Leserinnen und Leser in den weiteren Essays: Unglaublich schräg und Welten eröffnend seine Liebe zu Vögeln, unfassbar erhellend seine Liebe zur Literatur.
****** Wer je an einer Diplom- oder Abschlussfeier sprechen will, sollte an Franzens Rede Maβ nehmen
Kazuo Ishiguro: The Remains of the Day. London 1989.
Ishiguro erzählt die Geschichte eines alternden Butlers. Der Protagonist Stevens hat es in seiner Profession weit gebracht. Er beherrscht im englischen Landsitz Darlington Hall die Regeln seiner Kunst meisterhaft. Nichts, wirklich gar nichts kann ihn davon abhalten, seinen dienenden Pflichten in Würde nachzukommen. Nur: Was bleibt am Ende des Tages, wenn deutlich wird, dass die Regeln des Lebensspiels auch andere hätten sein können?
Der elegante und eigentümlich aus der Moderne gefallene Text des Romans bindet zunächst die Aufmerksamkeit seiner Leserinnen und Leser ans Vergegenwärtigen einer vergangenen großbürgerlichen Kultur. Der Landsitz Darlington Hall wird über die Tätigkeiten und Reflexionen seines ersten Butlers im Detail und auf allen Ebenen der kulturellen Leistungen ausgeleuchtet. Es geht u.a. um die geltende Rangordnung der Hausbewohner und Gäste, um die Art und Weise ihrer Kommunikation und ihres Verhaltens, um die Ausgestaltung und Pflege der Räume, des Mobiliars und der Gegenstände, ums Essen, Trinken, Schlafen, Lesen und damit auch um den gelebten Rhythmus im Tages- und Jahresverlauf. Mehr noch: Vor dem geistigen Auge der Lesenden wird auch der Austausch dieses außergewöhnlichen Oikos mit der Welt um die Mitte des 20. Jahrhunderts im kriegserschütterten Europa plastisch und nachvollziehbar. Beides zusammen ist Romanstoff genug und doch vermutlich nur Begleitmusik in diesem literarischen Meisterwerk.
Stevens, der Erzähler und gleichzeitig die Hauptfigur der erzählten Welt, wird nämlich von der ersten bis zur letzten Zeile des Romans in nicht nachlassender Dringlichkeit umgetrieben von der Frage nach der Würde eines Butlers. Ishiguro bietet meiner Einsicht nach an, sein facettenreiches Gesellschaftsporträt auch als Allegorie zu lesen: Darlington Hall steht für das Selbst eines Individuums. Was, wenn eine Person in ihrem Daheim bzw. Selbst der immer dienende Butler und nicht der Hausherr bzw. die Herrin des Hauses ist? Wenn Institutionen wie im Roman die „Hayes Society“ (der Berufsverband der Butler) oder andere Menschen (der Land Lord, diverse hohe Gäste) sogar bezüglich existentieller Erfahrungen der Liebe und des Todes von Nächsten zur Richtschnur des Handelns werden? Wenn der Dienst am vermeintlich Größeren, Wichtigeren, Anderen immer Priorität hat? Wenn die eigenen Einsichten und Emotionen den Geboten äußerer Instanzen stets untergeordnet werden? Ishiguro schreibt extrem zurückhaltend vom Verrat an der eigenen Person, was das Gewaltsame an dieser Treulosigkeit nicht etwa verschleiert, sondern im Gegenteil verstärkt.
***** Öffnet all jenen die Augen, die klammheimlich damit hadern, den Nobelpreis für Literatur noch nie bekommen zu haben
Benjamin Alire Sáenz: Aristotle and Dante Dive into the Waters of the World. New York 2021.
Aristotle Mendoza und Dante Quintana sind schnelle und helle Jugendliche, die in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts in den USA aufwachsen. Beide leben in bildungsnahen Familien und haben Eltern, wie man sie sich wünscht. Diese Eltern lieben ihre Söhne über alles; sie beschützen sie und beengen sie nicht; sie reden, schweigen, lachen, weinen (auch die Väter); sie haben ihren Beruf und sind stolz darauf; sie haben Freudinnen und Freunde; sie sind liebende EhepartnerInnen; sie sind in Krisen standfest und mutig; sie anerkennen Leid, Schmerzen, Schwierigkeiten, Schwäche bei sich selbst und bei ihren Kindern und ganz wichtig: sie räumen dem «Tod keine Herrschaft in ihren Gedanken» (Thomas Mann) und auch nicht in ihrem Leben ein.
Aufgehoben in einer solchen Atmosphäre werden die Jungen zu Männern, zu schwulen Männern. Das ist ein gewaltiger Schritt, zumal den beiden Protagonisten sehr klar ist, dass eine gesellschaftliche Mehrheit das Andere – was u.a. heisst: Homosexuelle, eingewanderte Latinos, Kriegsversehrte – nicht wahrnimmt und nicht will. Das omnipräsente, mal stumme, mal aggressive Votum «They don’t matter» einer dominanten Gesellschaftsschicht heisst für die Protagonisten zunächst «We don’t matter and don’t belong».
Wie kann es trotzdem gelingen, dass Jugendliche, die wissen, dass sie anders sind, zu lebenszugewandten Erwachsenen werden, die ihren Namen sichtbar einschreiben wollen/werden auf der Karte einer Welt, die es noch nicht gibt? Exakt das erzählt dieses Buch im Grossen und in Details. Die USP von Literatur entfaltet einmal mehr ihre überwältigende Kraft. Die Erzählerstimme gehört nämlich dem zurückhaltenden, zweiflerischen, reflektierenden und rhetorisch ausserordentlich begabten Aristotle. Er erlaubt und verschafft den Lesenden Einblick in die Welt der Gedanken, Gefühle und Handlungen von Heranwachsenden, die sich konfrontiert sehen mit dem Wunder und dem Schrecken der Liebe und Sexualität, mit dem Glück und Unglück des Lebens in seiner erwachsenen Form. Als ob das noch nicht genug wäre, lässt er sie teilhaben an der Erfahrung mit der Schreckensherrschaft der gesellschaftlichen Normalität.
Apropos: Was wir EuropäerInnen von amerikanischen AutorInnen lernen können? Unerschrockener einzutauchen ins Vokabular der Gefühle. Es fällt kein Stein aus der Krone der Zurückhaltungs-mentalität, wenn man sich ab und zu hinreissen lässt zum Bespielen des ganzen Spektrums und darüber hinaus. Kitschverdacht? Was für eine Nebensache.
***** Kanon-Lektüre für alle Gymnasiastinnen und Gymnasiasten der Welt und ihre Erwachsenen, mindestens
George Saunders: Fox8, London 2018.
«Deer Reeder: First may I say: sorry for any werds I spel rong.» Na, na! Was ist denn da passiert auf den ersten Zeilen von Georges Erzählung?! Und sofort die Erkenntnis: Natürlich, da schreibt ein Fuchs, der die Menschensprache soweit gelernt hat, dass er in der Lage ist, seine eigene Geschichte aufzuschreiben.
Literatur kann das: Der Autor kann eine Erzählerstimme erfinden und in seiner erzählten Welt etablieren, die in der realen Welt nicht zu uns spricht, jedenfalls nicht im englischen Idiom.
Fox8, der tagträumende poetische Fuchs, hat auf abendlichen Spaziergängen die Menschen und ihre Sprache entdeckt: «Yuman voice, making werds». Er ist hingerissen und naiv verliebt in die menschliche Gattung, die ihren Puppies Gutenachtgeschichten zu erzählen pflegt, Geschichten, die in seinen Ohren klingen wie «prety music». Die Ernüchterung folgt bald. Das Habitat der Füchse wird brachial zerstört: Trucks fahren auf und planieren nach der Waldrodung das Gelände – eine Shopping Mall entsteht und die Füchse hungern und sterben.
Fox8 gibt nicht auf bis zu jenem Punkt, wo er Zeuge des gewaltsamen Todes seines besten Freundes Fox7 wird. Arbeiter erschlagen den Fuchs, werfen ihn weg wie Abfall – und lachen. Fox8 versinkt in tiefe Trauer, aus der er erst wieder erwacht, weil seine eigene Vaterschaft bevorsteht. Er will kein Trauerkloss sein für seine Babies, bloss, wie wird er seine Trauer los? Indem er sein Entsetzen in Worte fasst. Er schreibt den Menschen einen Brief, erinnert sie an ihre Vorliebe für happy Ends ihrer Geschichten und erlaubt sich einen Rat: «If you want your Storys to end happy, try being niser.»
*** «Du musst dein Leben ändern». So lautet der berühmteste Appell der Literatur an ihre LiebhaberInnen. Für alle, die diesen Appell hören wollen
Tove Ditlevsen: Abhängigkeit. Kopenhagen 1971, dt. Berlin 2021.
Literatur ohne Gelehrsamkeit – gibt es das? Die 1917 geborene Ditlevsen ist bildungsfern aufgewachsen und von Kindsbeinen an schreibbesessen.
In ihrem Roman «Abhängigkeit» begegnet den Lesenden eine fragile und zugleich robuste Protagonistin, die im Strom des Lebens im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts in Kopenhagen als junge Frau steht und nicht unterzugehen sucht.
Glücklich ist sie, wenn sie schreibt und das Leben vergisst. Die Zumutungen wie Liebe, Schwangerschaften, Heiraten, Scheidungen, Abtreibung, Partys, Kinder, Freundinnen und Freunde setzen ihr gewaltig zu. Der Roman liest sich, als würde man in Echtzeit zuschauen, wie sich ein junges Frauenleben abspielt. Es gibt keine räsonierende, relativierende, erklärende, wertende Erzählerstimme. Man liest, was sich zuträgt – und das bis zum rasendsten Schmerz.
Die Protagonistin wird von einem ihrer Liebhaber, einem Arzt, mit Drogen versorgt. Die Geschichte der Abhängigkeit, des Entzugs, der Rückfälle und der Hoffnung auf Stabilität ist in stupender Unaufgeregtheit dargestellt. Das Monster «Sucht» entfaltet mit diesem leisen Gang und der Attitüde von Normalität seine ganze Brutalität.
**** Für alle über 20
Agnes Krup: Leo und Dora. Berlin 2022.
Krup erzählt die Geschichte einer späten Liebe. Die beiden im Titel genannten Protagonisten erfüllen die Erwartungen der Leserin so umfassend, dass Langeweile aufkommt, obwohl das Buch gut in der Hand liegt und ausserordentlich schön gestaltet ist:
Leo ist ein frustrierter, schreibgehemmter älterer Mann, der seine neue Ferienumgebung (die ihm notabene seine Verlegerin organisiert hat!) vergiftet mit dem Habitus des dauerverstimmten Alten.
Das weibliche Personal reagiert darauf mit beflissener Fürsorge und trägt dem schikanierenden Hahn ungefragt alles zu, was sein Herz begehrt: Ein Zimmer im Dach, eine Schreibmaschine, bestes Essen, Unterhaltung, strahlende Freundlichkeit und schliesslich eben auch Liebe.
** Für alle, die lieber schöne als gute Bücher in der Hand haben
Niviaq Korneliussen: Nuuk #ohne Filter. Wien 2021.
Literatur kann etwas Einmaliges: Innensicht präsentieren und das heisst, die menschliche Lust befriedigen, in den Kopf einer anderen Person zu schauen.
Korneliussen ist eine Meisterin der Innensicht, ihr Roman «ohne Filter» natürlich Programm. Nun ist die Form der literarischen Selbstdarstellung natürlich nicht neu. Die Autorin aber verblüfft mit Ton, Reflexionstiefe und Inhalt.
Es geht um Liebe in Zeiten der öffentlichen LGBTI-Debatten. Was ist die Bedingung der Möglichkeit für Liebe, was für Freundschaft? Wie fühlt es sich an, wenn es nicht mehr ums sexuelle Konsumieren, sondern um Liebe geht? Welchen Platz haben Liebeserfahrungen im Leben? Wie kommunizieren Menschen über diese Erfahrungen? Wie überwinden sie den Dualismus Gefühl-Verstand?
Grosse Fragen ohne sprachlichen Umweg angehen – das zeichnet Korneliussens Stimme aus. Selbstbefragung ohne weinerlichen Beigeschmack und ohne Selbstentblössung. Neue Erfahrungen brauchen neue Formen, wie schon Bertolt Brecht sagte. Der Autorin bleibt nichts anderes übrig, als das Projekt Sprache und Sprachen zu erneuern. Eine Heidenarbeit!
**** Für Frauen und Männer, die sich für Stimmen Heranwachsender interessieren
Iris Wolf: So tun, als ob es regnet. Salzburg-Wien 2017.
Mehrere Generationen im Osten des heutigen Deutschlands: Wolffs erzählte Welt umfasst im schmalen Roman viel erzählte Zeit. Das ist interessant, zumal die Weltgeschichte die Menschen in der dargestellten Region Europas sowie die Charaktere im Roman kräftig durchgeschüttelt hat.
Die Lektüre ist eine Tortur, da die Autorin ihren Stoff bilderreich und meiner Ansicht nach allzu bilderreich greift. Ein Beispiel gefällig? Der alte Elemér leidet an Schlaflosigkeit und beginnt, die Nacht zur favorisierten Zeit seiner Aktivitäten zu machen, was den Erzähler zu folgender Verlautbarung verleitet: «Er mochte das neue Versmaβ seiner Nächte.» Das ist eine stilistische Entgleisung der kitschigen Art, die leider nicht die einzige bleibt. Wie Denis Scheck auf dem Umschlag der Klett-Cotta-Ausgabe gerade die Stildimension des Romans rühmend erwähnen kann («Iris Wolff findet starke Bilder»), ist mir ein Rätsel.
** Anschauungsmaterial für Autorinnen und Autoren, wie Übersensibilität wirkt
Joachim B. Schmidt: Tell. Zürich 2022.
Wilhelm Tell ist der Schweizer Liebling unter den literarischen Figuren – er lebt seit Generationen im Repertoire all jener, die eine schweizerische Schullaufbahn hinter sich haben.
Schmidt nimmt sich die Tellsippe in den Zentralschweizer Bergen im Detail vors Dichterauge, erschafft lebendige Grossmütter, einen in den Bergen verunfallten älteren Bruder von Wilhelm, der der leibliche Vater des Tellensohns Walter ist und vieles mehr. Eine Fiktion wird re-fiktionalisiert, und das erstaunlich erfolgreich: Die Lektüre erstickt nicht im Nationalmythos, fächert sich auf, liefert sowohl zeitgeschichtliche als auch geografische Details und entwirft die Familiendynamik einer Bergsippe in entlegener Zeit.
Die Geschichte des sexuellen Missbrauchs durch den Pfarrer überfrachtet die ansonsten durch Reduktion und gleichzeitigen Detailreichtum ausgezeichnete Narration.
*** Sonntagslektüre für Intertextualitätsvernarrte
Wendy Mitchell: What I wish people knew about dementia. London 2022.
Demenzerkrankungen der verschiedensten Art sind ein gesellschaftliches Problem, dessen Brisanz mit der höheren Lebenserwartung der Menschen zunimmt.
Mitchell, selbst in relativ jungen Jahren geschlagen mit einer Demenz, spricht aus der Perspektive einer Betroffenen darüber, wie die Lebensqualität der Erkrankten verbessert werden kann, und das in den verschiedensten Lebensbereichen und auf allen Ebenen des menschlichen Erfahrens.
Zentrale Aussage, die über allen hilfreichen konkreten Erleichterungshilfen, die im Buch dargestellt sind, steht, lautet: Die demenzkranke Person ist mehr als ihre Krankheit; sie ist erkrankte Ärztin, Fotografin, Dozentin, erkrankter Künstler, Pfarrer, Landwirt. Wer eine Demenzdiagnose entgegennehmen muss, sollte Mitchells Stimme im Ohr haben, die auf das mitleidige und hilflose Schlucken eines eingeweihten Gegenübers sagt: «Oh no, don’t be sorry, I enjoy myself. Because I think I am having a good life at the moment, I’m doing what I want to do and what I like to do.» (167f.)
Allerdings kann nur so von sich reden, wer die volle Anerkennung der unheilbaren Krankheit durch die Gesellschaft geniesst – und das heisst auch, wer in der Gesellschaft als zugehörige Person mit der demenzspezifischen Einschränkung leben kann.
Allzu oft ist das für Personen, die an Demenz leiden, nicht der Fall. Sie werden als «Demente» adressiert und etikettiert, isoliert und bevormundet. Ihre Pflege/Betreuung hat standardisierten Regeln zu folgen und nicht ihren ganz und gar individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten.
**** Pflichtlektüre für Gesundheitspolitikerinnen und -politiker; Angehörige von Personen mit Demenz; Gefährdete, die sich vor der Krankheit fürchten; Betroffene; Pflegepersonal; Berater und Beraterinnen
Linda Scott: Das weibliche Kapital. München 20202.
Scott wirft das Auge auf das weibliche Wirtschaftskapital.
Der historische Blick fördert zu Tage, wie lange Frauen zunächst Eigentum waren; wie lange ihnen später Eigentum vorenthalten wurde und wie noch heute Frauen als Wirtschaftssubjekte systematisch verhindert werden (beispielsweise haben sie keinen Zugang zu den globalen Finanzflüssen: sie bekommen keine namhaften Kredite und keine grossen Aufträge; keine Teilnahmemöglichkeiten an ökonomischen Weltwirtschaftsforen und -kongressen; sind in der akademischen Ökonomie sträflich untervertreten).
In synchroner Perspektive decken die empirischen Studien auf, wie in grossen Teilen der Welt die historischen Rollen noch nicht überwunden sind: Frauen sind weiterhin Eigentum der Männer; geben ihren Verdienst den Männern ab; erwirtschaften das Überlebenskapital für die Ehemänner und Kinder, sind aber nicht erbberechtigt usw.
Theoretisch gesehen ist die ökonomische Stärkung der Frauen das wirksamste Armutsbekämfungs-programm. In den meisten Fällen managen Frauen ihr Kapital nachhaltiger und sozialverträglicher als Männer. Stärkung der Frauen als Wirtschaftssubjekte bedeutet gesamtökonomisch signifikant höhere Prosperität.
**** Pflichtlektüre für alle erwachsenen Frauen und Männer, die lesen können