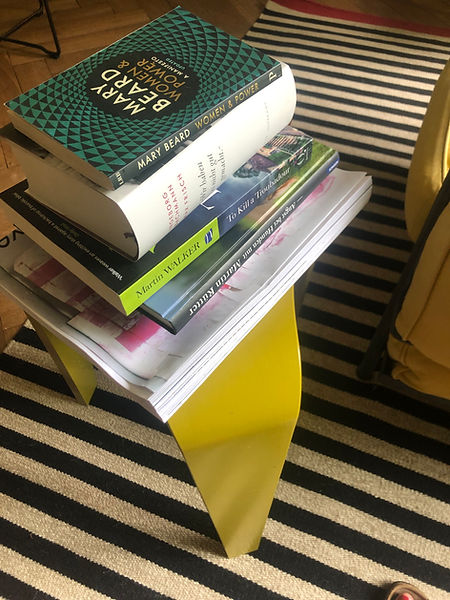


Gedichtjournal 2026
Ocean Vuong: Zeit ist eine Mutter. München 2022, 24.
Schöner kurz gewachsener Verlierer
Ich bin mir irgendwie voll mein eigener Fels. Da ist dieses späte Licht
im Garten, das Blut auf den Knochen
des Gatters wirft. Dieses Frühlingswogen, in dem wir ertrinken, um
zu verweilen & es so zu meinen.
Gedichtjournal 2025
Elisabeth Borchers: Begegnung. In: Akzente 23 (1976), 428.
Begegnung
Manchmal wird es immer kälter
und höchste Zeit das Wichtigste zu lernen.
Auch bei W.C. Williams,
Armenarzt in New Jersey,
ein ganzes Leben lang.
Als ich ihm das letzte Mal begegnete,
sagte er: Es ist ausgeträumt.
Ich notierte es. Eine Redewendung,
die mir brauchbar erscheint.
Elisabeth Borchers lyrischer Lakonismus steuert auf Einsicht zu. Das Unumgängliche in den Blick nehmen und Sprache dafür finden, könnte ein ihre poetische Kraft antreibendes Moment sein. Dinge beim Namen nennen, präzise sein, kein Dekor dulden. Ein solches Schreibprogramm ist auch jedem seriösen Journalismus eigen. Warum denn ein Gedicht schreiben? Was macht den Unterschied? Die Art der Referenz. Die Appellstruktur. Die Form. Die Kommunikation mit den Lesenden. Die überdauernde Gültigkeit des lyrischen Textes.
Wie journalistische Berichte referieren gelegentlich auch Gedichte auf reales Leben, also auf Zeit, Ort, Personen und Kontext. Aber sie tun es anders.
Die Zeitangaben in diesem Gedicht beispielsweise sind äusserst ungenau, also ganz und gar nicht journalistisch: «manchmal» (V1), «höchste Zeit» (V2), «ein ganzes Leben lang» (V5), «das letzte Mal» (V6). Wer «manchmal» sagt, hat das, was ins Auge gefasst wird, schon mehrmals erlebt. Es geht um ein Muster, nicht um etwas einzigartig Singuläres, das zur Sprache gebracht wird. Um dessen Wichtigkeit oder Dringlichkeit hervorzuheben, dient die alte Zeitmetapher «höchste Zeit», die besagt: Eigentlich hat man bereits keine Zeit mehr für das Anstehende. Und «ein ganzes Leben lang» – jene Dauer, die für Menschen wirklich Sinn macht – ist offensichtlich dem Immer-Wieder ausgesetzt, das «Wichtigste zu lernen» (V2).
Die generelle Erkenntnis der ersten zwei Verse illustriert das artikulierte Ich im Gedicht mit einem persönlich bezeugten Beispiel. Es referiert konkret auf den amerikanischen Lyriker und Arzt W.C. Williams (1883-1963) und seine lebenslange Tätigkeit in New Jersey. Person, Ort und Aufgabe werden konkret benannt. Mehr noch: Das artikulierte Ich zitiert den Armenarzt wörtlich und beurteilt seine Äusserung als «brauchbar» (V9).
«Es ist ausgeträumt» (V7). Ist diese Redewendung Ausdruck der Kapitulation oder vielmehr ein Appell, Neues anzusteuern? Gewiss letzteres. Die dringliche Aufforderung lautet: Wieder und wieder, also «manchmal», geht es darum, vom Träumen ins Handeln zu schalten. Das heisst zu definieren, was das Wichtigste ist, und dieses, nur und genau dieses, zu lernen. Die apodiktische Wendung «Es ist ausgeträumt» erweist sich insofern als «brauchbar», als sie den folgenreichen Kippmoment vom Träumen zum handelnden Gestalten wie ein Warnlicht anzeigt: Jetzt lernen und verändern. Jetzt.
Borschers Gedicht ist maximal generell im Thematisieren eines menschlichen Erfahrungsmusters und maximal subjektiv im sprachlichen Umgang mit dem Thematisierten. Diese erhellende Kombination, die ganz und gar ohne professoralen Gestus auskommt, nennt sich auch poetische Kommunikation.
Gedichtjournal 2024
Klaus Merz: Kostbare Nacht. In: Noch Licht im Haus. Innsbruck-Wien 2023.
Kostbare Nacht
Leermond, die Tür zur
Vergangenheit steht offen,
lichte Bilder treten hervor.
Unterm Brustbein
rumort für Augenblicke
ein gleißendes Glück.
Für N. L.
Vermutlich habe ich ein Vorurteil gegenüber Alterswerken von zeitgenössischen Dichtern. Ich fasse sie jedenfalls mit spitzen Fingern an und wappne mich: Larmoyanz, Selbstmitleid bzw. -überhöhung, Humor mit panischen Nebengeräuschen, Heldenpathos, Lebensüberdruss, Todessehnsucht, Resignation, Zynismus – nichts ist mir recht. Die freien Verse von Merz treffen umso überraschender mit der Wucht ihrer Schönheit und Wahrhaftigkeit. Im sprachlichen Bildbereich von «Nacht» und «Leermond», also von tiefer Finsternis, ereignet sich etwas, das in den Bildbereich des polaren Gegensatzes führt: eine «Tür […] steht offen», «lichte Bilder treten hervor», «gleißendes Glück rumort». Sechs Kurzverse präsentieren eins der kostbarsten Wunder des Lebens.
Einzigartig an der Darstellung dieser Präsentation ist deren Glaubwürdigkeit. Merz operiert mit dem großen Thema frech konkret. Das Glück, diese tausendfach beschworene humane Vision und Sehnsucht, hat im Gedicht einen Ort («unterm Brustbein»), eine Dauer («für Augenblicke»), eine Qualität («gleißend»), ein Verhalten (es «rumort») und einen mitbeteiligten Menschen («Für N.L.»). Genial, dieses griffige, reale Glück.
Doch damit nicht genug. Wie Merz im Detail ein Kleinod der sprachlichen Gestaltung hervorbringt, möge noch ein anderer Blick auf die zweite Strophe verdeutlichen. Freie Verse kommen ohne Endreime aus, sind jedoch auf vielfältige weitere Texturbindungen spezialisiert. Die U-Reihe „unterm Brustbein rumort“, der Stabreim „gleißendes Glück“, der Mittenreim „Brustbein, ein“, der sehr unreine Reim „Augenblicke und Glück“, all das (und noch viel mehr) ist poetische Kunstfertigkeit mit Strahlkraft. Die Verse sprechen sich leicht, es ist ein geradezu körperliches Vergnügen, sie zu reproduzieren.
So vitalisiert dieses kleine große Gedicht. Es korrigiert überhöhte Glücksvorstellungen. Es legt den Finger auf den Wert von Finsternissen. Und es testet sogar: Rumort es hie und da gleißend glücklich unter dem Brustbein? Wenn ja, dann leben Sie noch.
Interessanter Nachtrag: In der deutschen Lyrik findet sich das Verb «rumoren» auch bei einem alten Meister des Fachs. Heinrich Heine publizierte im Jahr 1854 (Heinrich Heine, Vermischte Schriften, Erster Band, Hamburg 1854, S. 134f.), also zwei Jahre vor seinem Tod, unter dem Titel «Babylonische Sorgen» eine selbstironische, aberwitzige Suada zu den Schrecken des durch Krankheit drohenden Abschieds von seiner Frau und von sich selbst. Das lange, metrisch regulierte und endgereimte Gedicht ist natürlich eine eigene Besprechung wert. Hier geht es jedoch einzig um den verblüffenden intertextuellen Bezug und darum stehen ausschließlich die vier letzten Verse des Gedichts zur Debatte. Sie lauten so:
Babylonische Sorgen (Heinrich Heine)
[…]
In meinem Hirne rumort es und knackt,
Ich glaube, da wird ein Koffer gepackt,
Und mein Verstand reist ab – o wehe –
Noch früher als ich selber gehe.
Unter dem Brustbein rumort es bei Merz, im Hirn bei Heine. Ach Herr Heine, Sie großes und unnachahmliches Vorbild! Ihre Stimme aus der beschwerlichen «Matratzengruft» klingt mehr als hundertfünfzig Jahre nach ihrem Verstummen absolut jung.
Ulrike Draesner: Nibelungen. Heimsuchung. Stuttgart 2016.
das metzeln das hunnen im ofen sein
das tosende licht, speckig treibt glut
fett aus holz das nichts mehr enthält.
männer schmelzen schädel gegen balken
gelehnt hält einer sich noch die hand
reines gebein vor augen die höhlen nur
flammen schlagen muster sackt wand
auf wand faucht das dach in den gang
bilden säulen neu aus körpern aus männern
sich bis knochen zerfliessen rotorange
auf dem boden verdampfende schrift.
noch immer ist es so: sie jagt
was sie sagt. menschen in rüstungen
die hitze speichern körper verbacken
sind leicht. schreie aus mündern
die es nicht mehr gibt gehen auf
letzte fahrt durch der helme schlitz.
was brüllt ist der feuersturm selbst
die sich feiernde materie reisst nagel
niete und jedes vergangene fest durch
jedes molekül der luft: noch immer ist es
so: sie sagt was sie jagt. die schatten:
rittertiere. als tanzten sie.
Ulrike Draesner, die 1962 in München geborene deutsche Literaturwissenschaftlerin und Autorin von Essays, Romanen, Erzählungen, Gedichten und einer Frankfurter Poetikvorlesung (Grammatik der Gespenster, 2018), veröffentlicht 2016 das hier abgedruckte titellose Gedicht in einem aufwändig illustrierten Zyklus «Nibelungen. Die Heimsuchung» im Reclam Verlag.
Die nur minimal strukturierten Verse vergegenwärtigen vermutlich ein Bild, das ich bislang nicht identifizieren konnte. Meine Hypothese, dass das Gedicht einerseits auf das mittelalterliche Nibelungenlied und andererseits auf einen ikonisch repräsentierten Kulturbestand – es könnte auch ein Film sein – referiert, konnte ich bislang weder verifizieren noch falsifizieren. Im Folgenden präsentiere ich zentrale Gedanken zur Hypothese.
Draesners Gedichte entstehen, wie sie in einem Interview mit Jan Wagner erklärt, in einem Arbeitsprozess, den die Lyrikerin «Stollenvortrieb» in sehr tiefer Gesteinsschicht nennt (Text+Kritik, 201/2014, 17). Was für das Auge in den tiefen Schichten einer Kultur noch nicht oder nicht mehr sichtbar ist, fördert sie in einem sprachlichen Umwandlungsprozess zutage. Poesie wird laut der Autorin dann zur Anwaltschaft des «wissenschaftlich Unsichtbaren» (Draesner: Fluoreszierende Mäuse, NZZ 29.01.2001), wenn sie in Sprache und Rhythmen übersetzt, was sich in den Tiefen des natürlichen und kulturellen Repertoires an Fossilierungen findet. Texte, Bilder, Skulpturen, Sprachen, Musik, Theater, Film – alles kann zum Material für die poetische Bearbeitung werden und zu neuen Aussagen führen.
Wie sich ein solcher Umwandlungsprozess gestaltet, zeigt das hier präsentierte Gedicht. Eine kulturelle Versteinerung, die sozusagen als «Subsong» den Gedichttext grundiert, ist die Erzählung des Racheakts von Kriemhild am Hofe des Hunnenkönigs Etzel. Kriemhild, die Hunnenkönigin, lädt ihre Brüder aus Worms an den Etzelhof ein, um sich an Hagen, dem Mörder ihres ersten Ehemanns Siegfried, zu rächen. Sie besteht darauf, dass Hagen ihr ausgeliefert wird, was die Burgunder ablehnen. Daraufhin lässt Kriemhild den Saal, in dem sich die Burgunder eingeschlossen befinden, anzünden. Die Wormser Recken kommen im Feuersturm allerdings nicht alle um (unter den Überlebenden ist auch Hagen); sie fangen das brennende Gebälk mit ihren Schilden ab (Das Nibelungenlied. 36. Âventiure. Karl Bartsch, hrsg. von Helmut de Boor. Mannheim 1988, 326ff.).
Die Grammatik der Verse dieses Gedichts entspricht keineswegs jener einer umgearbeiteten Narration der Nibelungenszene. Vielmehr zeigt sie das Wahrnehmungsprotokoll eines Schauplatzes der Zerstörung an. Was von der Netzhaut ins Gehirn transportiert wird, Seh-Element um Seh-Element, listet sich im Gedichttext auf: Das Metzeln; das Hunnen-im-Ofen-Sein; das tosende Licht; Männer schmelzen. Wo die Grenzen der einzelnen Elemente sind, ist nicht immer genau zu ermitteln, zumal Interpunktion und Zeilenumbrüche nur minimale Hinweise geben. Das Reihen der Elemente ohne Grenzmarkierung entspricht dem Seherlebnis bei einer Bildbetrachtung. Das Auge fokussiert ein Element, dessen Randzonen im unscharfen Bereich miterfasst und durch eine anschliessende Augenbewegung selbst ins Zentrum des Fokus gerückt werden können. Analog vollzieht sich die Lektüre des Gedichts als Suchbewegung: Wo beginnt ein Element, wo endet es? Was erfasst der erste Blick, was wird erst nach dem zweiten und dritten an Informationsvergabe nachgeschoben? Es liegt darum nahe, dass Draesner ein bestehendes visuelles Artefakt versprachlicht. Genauso plausibel ist aber, dass sie ein inneres (und bewegtes!) Bild der Nibelungensequenz zur verbalen Darstellung bringt. Betont wird in beiden Fällen der visuelle Zugang zum Schauplatz einer Zerstörung.
In der Tat: Draesner schaut, wie Kriemhild in Fritz Langs Film Die Nibelungen [1924], genau hin. Anders als die Figur im Film, die den Gewaltakt initiiert und verantwortet, die hasserfüllt und gebannt die Augen nicht von ihrem gnadenlosen Zerstörungswerk abwendet, vergegenwärtigt die lyrische Stimme als protokollierende Zeugin das Ausmass an Gewalt und Unmenschlichkeit des Racheakts. Diese Stimme ist nah am Gewaltgeschehen, sie sieht das menschliche Zerstörungspotential und seine Manifestationen – und findet Mittel, es distanziert, aber genau und schmerzhaft konkret auszudrücken. Rache reisst alles und jedes nieder. Sie macht nicht Halt, bis das, was sie jagt, zunichte gemacht, bis der letzte Schrei aus dem bereits nicht mehr existierenden Mund verhallt ist. Wie ein «brüllender Feuersturm» beseitigt sie, was kreatürlich und kulturell zusammenhält. Sie lässt «Knochen», die Stützen des menschlichen Körpers, «schmelzen». Sie verzehrt «Nagel und Niete», die materiellen Kohäsionsmittel, ebenso wie die sozialen Mittel des Zusammenhalts, die «vergangenen Feste». Sogar die «Schrift» und damit die Möglichkeit der menschlichen Verständigung «verdampft» in ihrer rasenden Hitze. Sie ist nicht zu besänftigen und kennt auf ihrem Weg der Gewalt keine Rücksichten; kollaterale Zerstörung nimmt sie in Kauf.
Das Gedicht lese ich als Mahnmal. Was dieser kurze Text anschaulich macht, soll sich nicht wiederholen. Seht hin, wenn Menschen metzeln, mahnt es, wenn «immer noch» gemetzelt oder wenn das menschliche Zerstörungspotential als Raserei sichtbar wird. Erlaubt euch nicht, wegzuschauen. Nehmt das bestürzende Immer-noch zur Kenntnis und durchschaut, was Gewalt anrichtet. Kriemhilds Rache-Feierlichkeiten, wie Hagen von Tronje im Nibelungenlied den Rachefeldzug der Hunnenkönigin nennt (ez ist ein übel hôhzît, die uns diu küneginne tuot), sind auch im 21. Jahrhundert als menschliche Handlungsmöglichkeiten «immer noch» nicht überwunden, obwohl sie uns wie die tanzenden Schatten einer längst vergangenen Ritterzeit vorkommen.
Raoul Schrott: Gleichnis I. In: Die Kunst an nichts zu glauben. München 2015.
GLEICHNIS I
nur narren sind favoriten des glücks
es erwischt uns stets überrücks
und glaubst du bei diesem passionsspiel
den schnürboden zu kennen
landest du im requisitenkeller der hinterlist
was immer das lebensziel
am ende bleibt man statist
eines dreigroschenstücks
mensch darf sich nennen
wer dabei nicht scheinheilig wird
gelobt sei wer irrt
Echt närrisch, die Konstruktion dieses Gleichnisses von Raoul Schrott! Es singt eine Stimme das Lob auf den Narren und auf die zutiefst menschliche Fähigkeit zu irren, indem sie Wesentliches aus dem Werkzeugkasten eines Poeten heranzieht, das für Dichtung mit lehrhafter Ausrichtung taugt und einem Alleswisser wohl ansteht. Bereits das erste Wort gibt den Ton an. Eine unscheinbare Partikel mit gerade mal drei Buchstaben eröffnet die Reihe der folgenden apodiktischen Formulierungen, die jeden Zweifel am Gesagten über die conditio humana unterbinden: «Nur» (Vers 1), «stets» (V2), «was immer» (V6), «am Ende bleibt» (V7) und als Höhepunkt die gnädige Erlaubnis «Mensch darf sich nennen, wer» (V9). Da spricht eine oder einer, die glaubt, den «Schnürboden» des menschlichen Lebens durchschaut zu haben – notabene nicht nur denjenigen seines oder ihres eigenen Lebens. Die Sprechstimme hat offensichtlich den Funktionshimmel über unser aller Leben verstanden, was unschwer an den verwendeten Personalpronomina und im generalisierenden «Mensch» abzulesen ist.
Wer so auf die Pauke der ewigen Weisheit haut, ist definitiv ein Scheinheiliger und Hypokrit. Doch Moment mal. Was floss mir eben in die Tastatur? «Wer x, ist y». Du Närrin! Du Favoritin des Glücks! Statistin in einem Dreigroschenstück!
Und eine Moral von der Geschicht? Nicht nur das Glück, auch die (Selbst)Erkenntnis überfällt uns gelegentlich «überrücks».
Dagmara Kraus: Galane. Dagmara Kraus · Lyrikline.org
galane
hätte casanova gewusst
dass er auf deutsch NEUHAUS heisst
wäre er bestimmt nicht so eitel gewesen
hätte mit dreiundzwanzig eine familie gegründet
bei der erstbesten versicherungsanstalt angeheuert
sich als freizeitküster am rande
einer friaulischen kleinstadt niedergelassen
und die alten beziehungskisten alle fest zugenagelt
wüsste neuhaus
dass er auf italienisch CASANOVA heisst
würde er sich gleich was drauf einbilden
frau und kinder verlassen
den buchhalterjob an den nagel hängen
sich zum chopinenfetisch bekennen und beginnen
mit einer dafür eigens angefertigten schwellzugfeder detailliert
tagebuch über die errungenschaften als schürzenjäger zu führen
Ein Familienname in zwei Sprachen, zwei historische Kontexte übers Kreuz gedacht und der an prominenter Stelle gesetzte Konjunktiv. Wenn diese poetische Reduktion im Gedicht von Dagmara Kraus zündet, hat das wenig mit den evozierten Bildern zu tun. Es ist nur mässig witzig, sich NEUHAUS verzückt vor Pantöffelchen und CASANOVA um Windeln bemüht vorzustellen. Was im Text hingegen sofort greift und befreit ist die Erinnerung daran, dass man, wie Robert Musil es formuliert hat, die Wirklichkeit als «Aufgabe und Erfindung» zu behandeln habe.
Mit anderen Worten: Wieder einmal – und keinmal zu viel – thematisiert und aktiviert ein Gedicht den Möglichkeitssinn, der als Konterpart zum überlebenswichtigen Realitätssinn allzu oft und ausschliesslich in den Sphären der Kunst wirkt. Wie beispielsweise in diesem Text. Die beiden Galane werden kraft des poetischen Möglichkeitssinns aus ihren ewigen Spurrinnen bzw. Fahrgleisen hinauskatapultiert. Der arme NEUHAUS gewinnt eine Perspektive jenseits der erstbesten Wirklichkeit am Rande der Gesellschaft in zugenagelten Verhältnissen und der arme CASANOVA muss nicht mehr nur Schürzen jagen.
Sieh dich mal anders! – und das Leben schwillt an wie die Verse im Gedicht.
Elisabeth Borchers: Adieu. In: Eine Geschichte auf Erden. Frankfurt am Main 2002.
Adieu
Und plötzlich bist du ganz allein
im Raum
der Welt
Die Ärzte legen ihre Kittel ab
Die Schläuche ziehen sich zurück
Die Hand hält an der Blüte fest
Der sternenübersäte Ort der letzten Atempause
rollt vorbei
Was weiβ denn ich
wohin
Borchers (1926-2013) formuliert ein endgültiges und gültiges Adieu. Ausgesprochen auf der Schwelle in den unbekannten Tod, ist dieses Abschiedswort klar, zart, konkret, unpathetisch und von jener zuversichtlichen Kraft, die sich wohl dann manifestiert, wenn Menschen gehen können. Können? Kann man sterben können? Wenn ja, zeigt Borchers Adieu eine der wohl unendlich vielen Möglichkeiten auf.
Der Gedichtanfang «Und plötzlich» ist allen vertraut als narrative Prozedur bzw. als Formel, die ein kommendes Ereignis ankündigt. Jedes Ereignis unterbricht den eher trägen Lebensstrom, in dem die Zeit regelmässig fliesst und alles seinen gewohnten Gang geht. Ein «Und plötzlich» wirft den Strom der alltäglichen Erlebnisse zu einer entscheidenden und alles verändernden Erfahrung auf, in Borchers Gedicht der Erfahrung der existentiellen Einsamkeit im Sterben: Du bist in der Stunde deines Todes «ganz allein», bezeugt die lyrische Stimme, und das nicht nur im Krankenzimmer («im Raum»), sondern – und hier öffnet diese Stimme mit dem Genitivattribut die Wände aller Sterbezimmer – ganz allein im «Raum der Welt».
Einfach und überzeugend konstituieren die grafischen Leerräume in den Versen zwei und drei die Erfahrung einer unbedingten Erweiterung ins Alleinsein, die in zwei weiteren Versen lakonisch protokollierend konkretisiert wird: «Die Ärzte legen ihren Kittel ab», «Die Schläuche ziehen sich zurück». Zwei kurze Hauptsätze genügen, um unmissverständlich klar zu machen, dass sich die bislang um Heilung bemühte Aussenwelt entfernt, um nicht wieder zu kommen.
Das scheint aber nicht das Ende zu sein. Hölderlin kommt mir in den Sinn. «Wo aber Gefahr ist, wächst/ das Rettende auch» (Patmos, 1802). Etwas anderes spielt sich im gleichen einfachen Hauptsatzmuster tatsächlich heran und verändert die Szenerie. Die Hand des oder der Sterbenden streckt sich nicht nach dem Verlorenen aus, weder nach dem Arzt noch nach dem Schlauch. Ganz allein und ganz in der Gegenwart des Sterbens richtet sich die Hand der sterbenden Person auf Naturgegebenheiten aus und «hält» sie «fest». Eine «Blüte» wird vergegenwärtigt, jener Inbegriff von Lebenskraft und Wachstum, aber auch von zarter Zerbrechlichkeit, dann der «sternenübersäte Ort der letzten Atempause». Blüte unter Sternenbaldachin, das Kleine, Fragile aufgehoben und geborgen im Sternenlicht der Unendlichkeit. Und wieder überrascht ein Genitivattribut: Der sternenübersäte Ort der letzten Atempause. Raum und Zeit, diese lebenslang von uns unterschiedenen und grundlegend orientierenden Kategorien des menschlichen Seins fallen im Sterben zusammen. In der letzten Atempause erreicht das Ich seinen angestammten Ort und einmaligen Platz in der Welt. Aber nur in diesem letzten Augenblick, der, den Gesetzen des Lebens und damit der Vergänglichkeit immer noch folgend, «vorbei rollt».
Nach diesem magischen Lebensmoment meldet sich die lakonische Stimme des lyrischen Ichs nochmals. Ausschliesslich in der Literatur – und das ist bemerkenswert – kann sich ein Ich auch dann noch artikulieren, wenn es nach den Gesetzen der empirischen Realität dazu gar nicht mehr in der Lage ist, weil der letzte Lebens- und damit auch Artikulationsaugenblick bereits vorübergerollt ist. «Was weiβ denn ich/ wohin», sagt das Ich im Gedicht. Flapsig fast, sicher aber unaufgeregt überlässt sich das Ich mit dieser Bemerkung dem unbekannten Wohin.
Ganz ohne Pathos, ohne Verklärung des Endes, nicht euphemistisch und ohne Selbstüberschätzung, freilich auch ohne Panik oder gar Entsetzen erfüllt Borchers Abschiedswort seinen Sinn. Im poetischen Wissen um die Geborgenheit der Blüte unter dem sternenübersäten Baldachin und im Nicht-Wissen darüber, was kommt, bleibt die sterbende Person mit den Lebenden verbunden. Das tröstet.